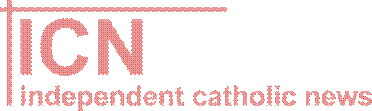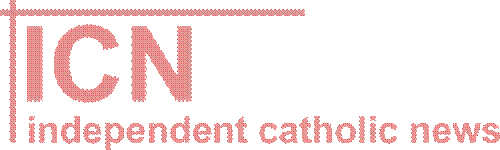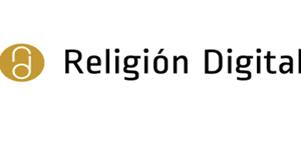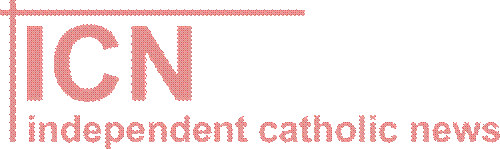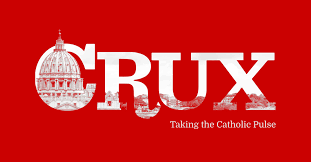r
60. Todestag von Camilo Torres:
SUCHEN SIE NICHT UNTER DEN TOTEN NACH
CAMILOS LEICHE
vor 60
Jahren, am 15. Februar 1966, wurde der kolumbianische Priester und Soziologe
Camilo Torres in Kolumbien bei einem Gefecht zwischen der kolumbianischen Armee
und der Guerilla ELN getötet. Vor wenigen Wochen hat nun ein Team forensischer
AnthropologInnen in Kolumbien seinen verschwundenen Körper gefunden.
Camilo
Torres stammte aus einer bürgerlichen Familie, studierte Theologie und
schließlich in Löwen Soziologie, was seine Vorstellung des Zusammenhangs von
Christentum und revolutionärer Weltveränderung prägte. Er gehörte zu einer
Generation junger ChristInnen, die ab Mitte der 1960er Jahre den Herrschaft und
Unterdrückung zurückweisenden Kern des Christentums ins Zentrum ihres
Selbstverständnisses stellten.
Torres war ein Wegbereiter der Befreiungstheologie und beeinflusste nach seinem
Tod die Bewegung der „Cristianos
por el socialismo“
in Chile 1971-1973, die einen wichtigen Anteil an der Theologie der Befreiung
hatte.
Er war Studentenpfarrer und hatte in der akademischen Jugend eine große
Anhängerschaft. Er war schließlich Mitbegründer der Fakultät für Sozio-logie an
der Nationaluniversität in Bogota, denn er verschrieb sich der Notwendigkeit
der Vermittlung von christlicher und gesellschaftlicher Praxis, bzw. von
Theologie und Sozialwissenschaften sowie der Vertiefung der Verbindung von
ChristInnen und MarxistInnen. Camilo Torres und viele WegbegleiterInnen kamen
zu dem Entschluss, dass sich eine christ-liche
Nachfolgeexistenz in die Teilnahme an gesellschaftlichen Kämpfen, wie die für
das Leben der verarmten Kleinbauern, übersetzen musste. Deshalb trat er 1965
der Guerilla bei, ging in den Untergrund und starb bei seinem ersten
Kampfeinsatz.
Seine Vorstellung, dass das Christentum eine Autonomie und Egalität fordernde
Bewegung und ihre wie auch immer geartete herrschafts-stabilisierende
Korrumpierung zurückzuweisen ist, hat eine drängende Aktualität. Dazu hat unser
kolumbianischer Freund, Carlos E. Angarita, in spanischer Sprache einen
lesenswerten Text veröffentlicht.
Vereinigung der Theologen und Theologinnen „Johannes
XXIII” – Madrid/Spanien
07. Januar 2026
Die „Vereinigung der Theologen und Theologinnen Johannes XXIII“ bringt ihre Empörung und ihre scharfe Verurteilung der imperialistischen Militäraktion des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gegen die Regierung und das Volk von Venezuela zum Ausdruck.
1. Die militärische Aggression stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht, die nationale Souveränität Venezuelas, die Menschenrechte, den Weltfrieden und die Grundprinzipien der politischen Ethik und der harmonischen Beziehungen zwischen den Völkern dar. Sie hat zur Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores sowie zur Ermordung von Dutzenden von Menschen, zur Verwundung weiterer Menschen, zum Angriff auf verschiedene Infrastrukturen und zur Destabilisierung der Region geführt.
2. Das Ziel der militärischen Intervention war nicht die Verteidigung der Demokratie, sondern die Aneignung des venezolanischen Ölmarktes, eines der reichsten der Welt. Das hat Trump in seiner Rede, in der er den Putsch zu rechtfertigen versuchte, unverhohlen zum Ausdruck gebracht und sogar von der amtierenden Präsidentin gefordert.
3. Wir halten Trumps Drohung für inakzeptabel, seine imperialistische Politik auf andere lateinamerikanische Länder wie Kuba, Kolumbien und Mexiko anzuwenden, indem er der Monroe-Doktrin folgt und die lange Geschichte der Staatsstreiche fortsetzt, die die Vereinigten Staaten weltweit praktizieren, und damit den Frieden in ganz Lateinamerika zerstört.
4. Wir verurteilen die imperialistische und koloniale Politik Trumps, die eine Verleugnung der Souveränität der Völker, eine Ablehnung des Multilateralismus in den internationalen Beziehungen, eine Einmischung in die Probleme anderer Länder und den Rückgriff auf Gewalt zu deren Beherrschung darstellt.
5. Wir erkennen an, dass Venezuela eine äußerst kritische politische, wirtschaftliche und soziale Lage durchlebt, dass die Menschenrechte missachtet werden und dass es bei den letzten Wahlen an Transparenz mangelte. Diese Probleme müssen von den Venezolanern selbst gelöst werden, aber auf keinen Fall durch solcher Art militärischer Aggression des Imperiums, wie sie jetzt stattfand.
6. Wir fordern:
· Die Achtung des Völkerrechts durch Trump.
· Den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Hoheitsgebiet Venezuelas.
· Die sofortige Freilassung von Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores.
· Die Wiederherstellung der Regierung Venezuelas.
· Die baldige Einberufung freier Wahlen
· Die Rückgabe der Souveränität an das venezolanische Volk.
· Das Bekenntnis zum Multilateralismus in den internationalen Beziehungen gegenüber jedem Imperialismus.
· Den Verzicht der Vereinigten Staaten auf imperialistische und kolonialistische Politik.
· Die Verteidigung der Demokratie gegenüber der Autokratie.
7. Unsere Verurteilung und die hier genannten Alternativvorschläge sind inspiriert von Protest Gebot Jesu von Nazareth: „Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. “ (Evangelium nach Markus 10,42-45).
8. Gegen die Anwendung von Gewalt als Mittel zur Unterdrückung der Völker empfehlen wir Wege des Friedens und der Gerechtigkeit, inspiriert von Bibeltexten, die uns den Weg weisen. In Psalm 85,11 heißt es: „Gnade und Wahrheit begegnen einander, Frieden und Gerechtigkeit küssen sich“ (Psalm 85,11). Der Prophet Jesaja kündigt vom „Frieden als Frucht der Gerechtigkeit“ (Jesaja 32,17). Jesus von Nazareth erklärt „selig sind, die Frieden stiften“ (Evangelium nach Matthäus 5,9) und hinterlässt seinen Anhängern und Anhängerinnen, aber auch allen Menschen guten Willens eine Botschaft, die sie in die Tat umsetzen sollen: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, aber nicht, wie die Welt ihn gibt“ (Johannes 14,27).
Trump, der sich verbal als Christ bezeichnet, beweist mit seinen imperialistischen und putschistischen Praktiken, wieweit er vom prophetischen und jesuanischen Ideal des Friedens und der Gerechtigkeit entfernt ist.
9. Diese Empfehlungen entsprechen jenen von Menschen und Gruppen, die sich für die Suche nach Wegen des Friedens und der Gerechtigkeit bei der Lösung von Konflikten engagieren. Trump, der sich verbal als Christ bezeichnet, beweist mit seinen imperialistischen und putschistischen Praktiken, wieweit er vom prophetischen und jesuanischen Ideal des Friedens und der Gerechtigkeit entfernt ist. Deshalb denunzieren und verurteilen wir seine militärische Aggression gegen Venezuela sowie viele andere unterdrückerische Handlungen gegen schutzbedürftige Menschen, verarmte Gruppen und unterdrückte Völker, deren Rechte er mit Füßen tritt.
10. Auf Grund unserer politischen Ethik und unseres christlichen Glaubens können wir angesichts einer solchen Verletzung des internationalen Rechts, die der gesamten Menschheit Schaden zufügt, nicht schweigen. Deshalb haben wir beschlossen, diese Erklärung zu veröffentlichen.
Übersetzung: Norbert Arntz, Kleve
Erklärung
der Jerusalemer Kirchenführer zum Waffenstillstand im Gazastreifen
[Der Allmächtige] macht den Kriegen ein Ende bis an die Enden der Erde. Er zerbricht den Bogen und zerschmettert den Speer, er verbrennt die Schilde mit Feuer. Er sagt: ‚Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Völkern, ich werde erhöht werden auf Erden.‘“ (Psalm 46:9-10)
Gemeinsam mit Millionen Menschen in unserer vom Krieg heimgesuchten Region und Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt freuen wir, die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem, uns über die kürzlich erfolgte Verabschiedung des Waffenstillstands im Gazastreifen und die Freilassung der Gefangenen.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um die enormen Anstrengungen all jener in der internationalen Gemeinschaft anzuerkennen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese große Errungenschaft zu erreichen.
Wir hoffen und vertrauen darauf, dass diese erste Phase des Waffenstillstands das Ende des Gaza-Krieges einläutet und dass etwaige weitere Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien durch Verhandlungen und Vermittlung mit äußerster Zurückhaltung beigelegt werden, anstatt die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen. Tatsächlich hat unsere Region als Ganzes lange genug gelitten, um etwas anderes in Erwägung zu ziehen. Jetzt ist es an der Zeit, den langen Weg der Heilung und Versöhnung zu beschreiten, der zwischen Palästinensern und Israelis so dringend notwendig ist.
Wir sind besonders ermutigt durch das Engagement der Teilnehmer des Gipfeltreffens in Scharm El-Scheich, das den Beginn dieses Abkommens markierte, und vieler anderer internationaler Akteure. Wir hoffen, dass diese beeindruckende globale Mobilisierung bald zu einer groß angelegten humanitären Operation führen wird, die den Palästinensern im Gazastreifen und anderen Gemeinschaften in unserer Region, die weiterhin unter Vertreibung, Tod, Verletzungen, Hunger und Verlust ihrer Lebensgrundlage leiden, sofortige Hilfe bietet. Wir fordern daher eine rasche Versorgung des Gazastreifens und anderer betroffener Gemeinschaften mit nicht nur Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, Treibstoff und medizinischen Hilfsgütern, sondern auch mit Notunterkünften und medizinischen Einrichtungen. Dies ist der Auftakt zu einem rasch umzusetzenden und umfassenden Programm zur massiven Räumung und zum Wiederaufbau zerstörter Häuser, Geschäfte und ziviler Infrastruktur.
Gleichzeitig beobachten wir weiterhin mit großer Sorge die zunehmende Gewalt gegen die Bevölkerung im Westjordanland im Zusammenhang mit der Ausweitung der Siedlungen. Wir appellieren daher an die betroffenen Parteien und die internationale Gemeinschaft, die laufenden Verhandlungen auf ein Ende der Besatzung des Westjordanlands und des Gazastreifens auszuweiten und die Gründung eines palästinensischen Staates zu fordern, der friedlich neben dem Staat Israel existiert. Nur so kann unserer Ansicht nach ein gerechter und dauerhafter Frieden im Heiligen Land und im gesamten Nahen Osten erreicht werden.
Wir möchten auch den Bewohnern der orthodoxen Kirche St. Porphyrios und der katholischen Kirche der Heiligen Familie sowie den Mitarbeitern des anglikanischen Al-Ahli-Krankenhauses besondere Ermutigung aussprechen: Ihr unermüdlicher Glaube in den unermesslichen Härten der letzten zwei Jahre war für uns alle ein leuchtendes Beispiel. Wir versprechen Ihnen unsere anhaltenden Gebete und Unterstützung und werden uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die kommenden Wochen und Monate Ihr Vertrauen in Gottes Vorsehung rechtfertigen.
In diesem Geist danken wir gemeinsam mit unseren Mitchristen und anderen Menschen guten Willens auf der ganzen Welt dem Allmächtigen, der uns zu diesem glückverheißenden Moment geführt hat, auch wenn wir wissen, dass die Friedensarbeit gerade erst begonnen hat. Möge Gott uns allen die Gnade schenken, uns dieser wichtigen Aufgabe erneut zu widmen und uns in das goldene Zeitalter des Friedens zu führen, das die Propheten und Weisen der Antike so lange vorausgesehen haben und für das unser Herr Jesus Christus selbst sein Leben gab und zu neuem Leben im Jenseits auferstand.
-Die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem
Ian Linden: Völkermord – Der Macht
die Wahrheit sagen
Hoffnung und
Freude sind wunderbare Geschenke. Die Geiselnahme ist vorbei, die endlosen
Bombenangriffe und Morde in Gaza hören auf. Man würde nicht glauben, dass es in
Gaza zuvor bereits zwei Waffenstillstände mit Gefangenenaustausch und einer
kurzen humanitären Hilfslieferung gegeben hatte.
Die Palästinenser müssen bittere Trauer und unvorstellbares Leid verarbeiten:
Völkermord und eine neue Form der Apartheid im Nahen Osten. Der Weg in die
Zukunft ist versperrt. Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit und für die
meisten auch nicht in ihre Heimat. Juden weltweit sind mit einem starken
Anstieg des Antisemitismus konfrontiert, in Israel mit dem Verlust von 1.200
Mitbürgern durch die Hamas und langfristig mit einer Verringerung der
US-Unterstützung.
Vor vierzig Jahren, auf dem Höhepunkt der Mobilisierung gegen Apartheid und Unterdrückung in Südafrika, betrachteten Theologen die damaligen Ereignisse als einen Kairos, einen kritischen Moment voller großer Chancen und großer Gefahren. Für Palästina besteht die Chance nun darin, die Schwäche der Hamas und Trumps – wankelmütigen – Druck auf Israel auszunutzen. Die Gefahr besteht darin, dass die Verantwortung für den Völkermord unter den Tisch gekehrt wird. Der Preis dafür, dass der Friedensplan über die erste Phase hinausgeht, ist ein schwerer Schlag, der das Völkerrecht ernsthaft untergräbt und möglicherweise irreparabel ist.
Im Völkerrecht
ist Völkermord genau definiert. Wenn Völkermordvorwürfe rechtlich bewiesen
sind, können die Täter angeklagt werden – und das wird auch getan. Der
ehemalige Präsident Serbiens, Slobodan Milošević, wurde beispielsweise
wegen Völkermord und Kriegsverbrechen angeklagt, starb jedoch im Gefängnis.
Auch ohne Verurteilung hat dies Konsequenzen. Die Beschwerde Südafrikas vor dem
Internationalen Gerichtshof (IGH) aus dem Jahr 2024 führte dazu, dass der
Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen die Hamas und drei
israelische Politiker erließ. Netanjahu mied auf dem Weg zur
UN-Generalversammlung den Luftraum mehrerer europäischer Länder, die er hätte
überfliegen sollen.
Die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der UN für die besetzten
palästinensischen Gebiete vom 16. September 2025 bietet eine ausführliche,
detaillierte und beweisgestützte Analyse des Verhaltens der israelischen
Regierung und ihrer Streitkräfte. Um die Schuld am Völkermord festzustellen,
sind sowohl Tat- als auch Absichtsnachweise erforderlich. Das Urteil der
Kommission basiert daher sowohl auf einer detaillierten Analyse der Tatbestände
(Handlungen der israelischen Streitkräfte, Massentötungen, die der
palästinensischen Bevölkerung ganz oder teilweise die Lebensgrundlage entzogen
und ihr schwere körperliche und seelische Schäden zugefügt wurden) als auch auf
der mens rea (Beweise für die Absicht der Regierung,
Völkermord zu begehen). Das Fazit der Untersuchung lautete: „Der Staat Israel
trägt die Verantwortung für das Versäumnis, Völkermord zu verhindern,
Völkermord zu begehen und den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen
zu bestrafen.“ Dies wurde in folgenden Kontext gestellt: „Die Ereignisse im
Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 haben sich nicht isoliert ereignet …
Ihnen gingen Jahrzehnte unrechtmäßiger Besatzung und Unterdrückung im Rahmen
einer Ideologie voraus, die die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung
von ihrem Land und ihre Umsiedlung forderte.“
Der Vatikan
reagiert auf Menschenrechtsverletzungen und Konflikte, wo immer sie auftreten.
Was also hat die katholische Kirche zu Gaza gesagt – wo sich noch immer eine
winzige christliche Bevölkerungsgruppe festklammert, die durch die täglichen
Telefonanrufe von Papst Franziskus mit der Kirche der Heiligen Familie bekannt
wurde?
Am 29. September 2025 gab Erzbischof Paul Gallagher, vatikanischer
Staatssekretär für die Beziehungen zu den Staaten, bei der Eröffnung der 80.
Sitzung der UN-Generalversammlung einen fundierten globalen Rundgang, der die
Ukraine, die Rohingya, Darfur, das Grenzgebiet zwischen Ruanda und der
Demokratischen Republik Kongo, Haiti und den Südsudan umfasste, und gab eine
klare Erklärung zu den ethischen Normen ab, die das Verhalten von Soldaten im
Kampf regeln. Die Begriffe Völkermord oder Kriegsverbrechen verwendete er
nicht. Doch am Sonntag, dem 17. November 2024, zitierten Vatican
News und die italienische Tageszeitung La Stampa Papst Franziskus in einem
Interview mit den Worten, einige internationale Experten hätten erklärt, dass
„das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermords aufweist“, und
forderten eine Bewertung dieser Tatsache.
Päpstliche Erklärungen
nennen keine Namen und sind traditionell verallgemeinernd. In einer Botschaft
an die Teilnehmer der jährlichen Konferenz der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation (FAO) am 30. Juni dieses Jahres schrieb Papst Leo,
er sei „derzeit mit Verzweiflung Zeuge des ungerechtfertigten Einsatzes von
Hunger als Kriegswaffe“. Erzbischof Gallagher sagte in seiner Rede vor der
UN-Generalversammlung: „Militärangehörige bleiben voll verantwortlich für
jegliche Verletzung der Rechte von Einzelpersonen und Völkern oder der Normen
des humanitären Völkerrechts. Solche Handlungen können nicht durch Gehorsam
gegenüber Befehlen von Vorgesetzten gerechtfertigt werden.“ Die IDF schienen
die ungenannten Militärangehörigen zu sein, an die sie dachten.
Caritas Internationalis ist die erfahrene offizielle
humanitäre Organisation der Kirche mit weltweiter Präsenz. Sie schafft es
selten in die Schlagzeilen. Am 25. August 2025 veröffentlichte Vatican News, das offizielle Online-Portal des Heiligen
Stuhls, einen Artikel mit dem Titel „Caritas Internationalis:
Hungersnot in Gaza verstößt gegen die Völkermordkonvention“, eine vernichtende
Verurteilung des vorsätzlichen Aushungerns der Bevölkerung von Gaza. Abgesehen
von den Independent Catholic News wurde über die Caritas-Erklärung kaum
berichtet.
Auch auf Ebene der Bischofskonferenzen herrscht Zurückhaltung, Verantwortung
zuzuweisen und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zu
sprechen. Mit Ausnahme der Einwanderungsfrage wird nur zögerlich auf politische
Themen eingegangen (obwohl die amerikanischen Bischöfe auf Druck von Franziskus
und Leo reagierten, die ihnen kürzlich einen Brief schrieben, in dem sie
aufgefordert wurden, sich zu äußern). Im Fall Gaza ist zudem die antisemitische
Geschichte der Kirche ein Thema, das Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem
extremistischen Zionismus erfordert.
Die Kirche sieht ihre Rolle in Konflikten darin, sich für Versöhnung einzusetzen, eine Vermittlung zu versuchen und so zwischen den streitenden Parteien Stellung zu beziehen, nicht Partei zu ergreifen. Und die Sprache muss dieser Aufgabe angemessen sein. Doch die Erfahrung des südafrikanischen Dominikanertheologen Albert Nolan OP in der Ausnahmesituation der Apartheid stellte diesen Ansatz in Frage. „Es gibt keinen neutralen Ort zwischen dem Gefolterten und dem Folterer“, pflegte er zu sagen. Das Dilemma der Kirchenführer in solchen Situationen verschärft sich, wenn man sich weigert, die Existenz von Feinden zuzugeben. Oder wenn keine klare Vorstellung davon besteht, wer oder was der Feind ist. Doch die Sprache des Magnificat, das wir beim Abendgebet im Dominikanerkloster in Johannesburg gebetet haben, ist kompromisslos und ergreift klar Partei. „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.“
Versöhnung ist schwierig und komplex. Es ist leichter, darüber im Prinzip zu reden als in der Praxis. Versöhnung zwischen, sagen wir, Familienmitgliedern unterscheidet sich von der Versöhnung zwischen Nationen und Gruppen, die sich durch unterschiedliche Kulturen, Geschichten und Merkmale auszeichnen. Ein weiterer, direkt relevanter und häufiger erwähnter Vorbehalt ist, dass ein Aufruf zur Versöhnung zwanghaft wirken kann, wenn er nicht – wie traditionell von der Kirche vertreten – mit dem Streben nach Gerechtigkeit verbunden ist.
Die Bischöfe predigen nicht nur das Evangelium und fördern ethische Normen, sondern teilen auch ihre Gefühle mit. Sie sind „zutiefst schockiert“ oder „traurig“ und fühlen mit den Opfern. Doch eine Analyse der Ursachen und der Verantwortlichen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wird selten geteilt. Israel und seine übergroße, von den USA finanzierte Militärmacht haben die Macht und üben sie aus. Das Bekenntnis zu einem christlichen Machtverständnis und dessen Umsetzung sollte nicht durch übertriebene Vorsicht beeinträchtigt werden.
Leider kann es in der heutigen Welt der Wirtschaft schaden, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Nicht so für die Kirche. Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden – das sind wir dem palästinensischen Volk schuldig. Der friedliche Protest gegen den Völkermord im Gazastreifen und die vom israelischen Staat praktizierte Apartheid muss fortgesetzt werden.
Professor Ian Linden ist Gastprofessor an der St. Mary's University in Strawberry Hill, London. Als ehemaliger Direktor des Katholischen Instituts für Internationale Beziehungen wurde er im Jahr 2000 für seinen Einsatz für Menschenrechte mit dem CMG ausgezeichnet. Er war außerdem Berater für Europa sowie Gerechtigkeit und Frieden in der Abteilung für internationale Angelegenheiten der katholischen Bischofskonferenz von England und Wales. Ian leitet eine neue Wohltätigkeitsorganisation für außerschulische Bildung in Beirut für syrische Flüchtlinge und libanesische Kinder, die vom Schulabbruch bedroht sind. Er arbeitet mit CARITAS Libanon zusammen und ist Vorstandsmitglied des Las Casas Institute in Oxford, zusammen mit Richard Finn OP. Sein letztes Buch „Global Catholicism“ erschien 2009 bei Hurst.
LINK
Ian Linden: www.ianlinden.com/latest-blogs/
Bischof
Nicholas Hudson, Vorsitzender der Abteilung für internationale Angelegenheiten
der Bischofskonferenz, hat sich denjenigen angeschlossen, die das Vorgehen
Israels im Gazastreifen verurteilen.
Bischof Nichols Hudson vom katholischen Bischofsamt von England und
Wales hat sich Papst Leo und den lateinisch- und griechisch-orthodoxen
Patriarchen von Jerusalem angeschlossen und verurteilt das Vorgehen Israels im
Gazastreifen.
Er sagte: „Ich möchte die Kritik der Patriarchen an den Maßnahmen der israelischen Regierung verstärken. Sie sagen: ‚Das ist nicht der richtige Weg. Es gibt keinen Grund, der die vorsätzliche und gewaltsame Massenvertreibung von Zivilisten rechtfertigt.‘“
Die lateinischen und griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem gaben am Dienstag eine gemeinsame Erklärung zu Gaza heraus, in der sie ihren Respekt für die Geistlichen und Nonnen der beiden christlichen Gemeinden in den Stadtteilen von Gaza-Stadt, der lateinischen Pfarrei der Heiligen Familie und der griechisch-orthodoxen Pfarrei St. Porphyrius, zum Ausdruck brachten.
Angesichts der Zwangsvertreibung haben sie sich entschieden, zu bleiben und sich weiterhin um die Schwachen, Behinderten und alle zu kümmern, die in ihren Unterkünften Zuflucht suchen. Jeder Versuch, in den Süden zu fliehen, sei „nichts weniger als ein Todesurteil“, sagten sie.
Auch Papst Leo XIV. schloss sich gestern dem Aufruf an. In der vergangenen Woche hatte er zu einem Tag des Gebets und Fastens für den Frieden aufgerufen, der am Freitag stattfand. Gestern erneuerte er seinen Appell an die beteiligten Parteien und die internationale Gemeinschaft: „Der Konflikt im Heiligen Land, der so viel Terror, Zerstörung und Tod verursacht hat, muss beendet werden.“
Er forderte außerdem die sichere Einfuhr humanitärer Hilfsgüter nach Gaza und den Schutz der Zivilbevölkerung. „Ich appelliere an die Freilassung aller Geiseln, die Aushandlung eines dauerhaften Waffenstillstands, die Erleichterung der sicheren Einfuhr humanitärer Hilfsgüter und die uneingeschränkte Einhaltung des humanitären Völkerrechts, insbesondere der Verpflichtung zum Schutz der Zivilbevölkerung und des Verbots kollektiver Bestrafung, wahlloser Gewaltanwendung und Zwangsvertreibung.“
Bischof Hudson sagte: „Ich mache mir große Sorgen um Pater Gabriel Romanelli und die Gemeinde der Heiligen Familie in Zeytoun. Pater Romanelli hat unermüdlich daran gearbeitet, die Menschen in der Gemeinde zu schützen, insbesondere die Kinder, die, wie er sagt, sich mit dem Schrecken der Ereignisse um sie herum abgefunden haben. Er betet mit ihnen und versucht, sie von der Gewalt abzulenken. Er tröstet alle, die in der Heiligen Familie Zuflucht suchen, mit den Sakramenten der Kirche und der Gewissheit, dass Christus sie bei sich trägt und mit ihnen leidet. Wir müssen jetzt unsere Gebete für alle, die dort bleiben, verdoppeln.
Ich schließe mich den Patriarchen an und verurteile das Vorgehen der israelischen Regierung. Ihr Vorgehen ist falsch und die vorsätzliche und gewaltsame Massenvertreibung von Zivilisten lässt sich nicht rechtfertigen. Denn, wie die Patriarchen sagen: „Es kann keine Zukunft geben, die auf Gefangenschaft, Vertreibung von Palästinensern oder Rache beruht.“
Kein Land kann dauerhafte Sicherheit finden, wenn es seinem Nachbarn Gerechtigkeit und Menschenrechte verweigert. Dieser Krieg muss jetzt enden. Die von der Hamas festgehaltenen Geiseln – lebende und tote – müssen ihren leidenden Familien zurückgegeben werden. Und die zwei Millionen Gaza-Bewohner, die von Hunger und Bombardements heimgesucht werden, müssen die Lebensmittel und medizinische Versorgung erhalten, die sie dringend benötigen.
In ihrem gemeinsamen Friedensappell für Gaza erklärten die lateinisch- und griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem, es gebe keinen Grund, die „vorsätzliche und gewaltsame Massenvertreibung von Zivilisten“ zu rechtfertigen. Der Kreislauf der Gewalt müsse beendet und das Gemeinwohl an erster Stelle stehen. „Es hat genug Zerstörung gegeben, in den Gebieten und im Leben der Menschen“, sagten sie. „Es gibt keinen Grund, Zivilisten unter dramatischen Bedingungen als Gefangene und Geiseln zu halten. Es ist jetzt Zeit für die Heilung der leidgeprüften Familien auf allen Seiten.“
1. August 2025
Leitartikel:
Völkermord oder nicht, Israels unerbittliche Angriffe in Gaza
überschreiten moralische Grenze
Die Schlagzeilen, die von Tag zu Tag düsterer werden, sind unerbittlich. Die Brutalität des andauernden Angriffs Israels auf den Gazastreifen ist atemberaubend. Die Zerstörung von Städten und die Ermordung von Zivilisten, das Aushungern von Frauen und Kindern ist unbeschreiblich.
Das Vorgehen Israels im Gazastreifen hat zu einer bemerkenswerten Schlagzeile - und einem Wort - geführt, das früher vielleicht undenkbar gewesen wäre:
"Führende israelische Menschenrechtsgruppen beschuldigen Israel erstmals des Völkermords im Gazastreifen", The New York Times, 28. Juli 2025
In den Berichten über Frauen und Kinder, die auf langen Wanderungen zu den Lebensmittelstationen zwischen dem Verhungern oder dem Tod durch das israelische Militär wählen mussten, klingt das Grauen nach, das das moderne jüdische Leben geprägt hat.
Israel führt "koordinierte Aktionen durch, um die palästinensische Gesellschaft im Gazastreifen absichtlich zu zerstören", so die Gruppen B'Tselem und Physicians for Human Rights - Israel in ihrem Bericht "Our Genocide". Diese Absicht bedeute, dass "Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begehe", heißt es in dem Bericht.
Dass die Israelis ihre Kritik an der Kampagne in Gaza auf dieses Niveau heben, ist eine erstaunliche Entwicklung. Das Wort Völkermord wurde geprägt, um den Versuch Deutschlands zu beschreiben, die Juden auszurotten, und hat im internationalen Recht eine bestimmte Bedeutung. Dass jüdische Mitbürger nun das Wort Völkermord verwenden, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Israel zumindest eine moralische Grenze überschritten hat.
Diese beiden Menschenrechtsgruppen sind keine vereinzelten Stimmen.
Der ehemalige Premierminister Ehud Olmert hat in einem Gastbeitrag in der israelischen Zeitung Haaretz und auf CNN erklärt, dass die Israelis im Gazastreifen Kriegsverbrechen begehen. "Was wir jetzt in Gaza tun, ist ein Krieg der Verwüstung: wahlloses, grenzenloses, grausames und kriminelles Töten von Zivilisten", schrieb er. "Es ist das Ergebnis der Regierungspolitik - wissentlich, bösartig, böswillig, unverantwortlich diktiert. Ja, Israel begeht Kriegsverbrechen."
In einem Interview mit NPR sagte Omare Bartov, ein Holocaust-Gelehrter, der in Israel aufgewachsen ist und im israelischen Militär gedient hat, dass er anfangs gezögert habe, das Wort Völkermord zu verwenden. Schließlich sei er zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem, was er beobachtete, um einen absichtlichen Versuch handelte, "Gaza systematisch zu zerstören. ... und es dieser Gruppe unmöglich zu machen, ihre Identität als Gruppe wiederherzustellen, indem alles, was dort ist, vollständig ausgelöscht wird, wenn dies jemals vorbei ist.
Ein Bericht der Vereinten Nationen kam im März zu dem Schluss, dass Israel Völkermord begangen hat. Am 3. Juli erklärte Amnesty International, dass "Israel weiterhin den Hunger der Zivilbevölkerung als Kriegswaffe einsetzt", als "Teil seines andauernden Völkermordes."
Allerdings gibt es auch Stimmen, die Israels Kampagne nicht als Völkermord bezeichnen. John Spencer, ein Veteran der US-Armee, der in West Point urbane Kriegsführung studiert, sagte auf NPR, er habe israelische Zivil- und Militärbeamte interviewt und sich bei den israelischen Verteidigungskräften in Gaza eingebettet, aber er habe nicht mit Palästinensern gesprochen.
"Der Premierminister, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef sagen, dass unser Kampf nicht gegen die Menschen in Gaza gerichtet, sondern gegen die Hamas", sagte Spencer. "Und all die Berge von Beweisen dafür, was Israel tut, um die Infrastruktur zu erhalten, das zivile Leben zu schützen, Dienstleistungen zu erbringen ... Ich meine, die Anzahl der Feldlazarette, die Anzahl der Wasserleitungen, die Menge der Hilfsgüter. All diese Dinge widersprechen der Behauptung des Völkermordes", sagte er.
Die Beweislage für Spencers Argumentation wird von Tag zu Tag, wenn nicht sogar von Stunde zu Stunde dünner, da die Zahl der Toten immer weiter steigt - und diese Zahlen werden weithin als zu niedrig eingeschätzt, und die Zerstörung und der Hunger gehen weiter.
Ob die Zerstörung des Gazastreifens in irgendeinem offiziellen und rechtlichen Kontext jemals als Völkermord angesehen werden kann, ist kaum der zentrale Punkt. Die Debatte wird zweifelsohne weitergehen. Was zählt, ist die wachsende Wahrnehmung unter Israelis und Juden anderswo, dass Israels Militärkampagne in Gaza jede vernünftige Rechtfertigung übersteigt und jedes politische Argument für die Fortsetzung des Krieges untergräbt.
Der Antisemitismus ist auf dem Vormarsch und bleibt eine zersetzende Kraft in den Vereinigten Staaten. Die öffentlichkeitswirksame und offene Kritik von Juden an Israel und die Weigerung von Premierminister Benjamin Netenyahu, die Gewalt zu stoppen, haben jedoch dazu beigetragen, den Vorwurf zu entkräften.
Oft sind es Elemente innerhalb Israels, die die Dinge richtig stellen.
Eine Untersuchung von Haaretz ergab, dass israelische Soldaten den Befehl erhalten hatten, in der Umgebung von Lebensmittelverteilungszentren auf Zivilisten zu schießen.
Das israelische Militär bestreitet nun die Behauptung der eigenen Regierung, dass die Hamas regelmäßig Lebensmittel für die Zivilbevölkerung in Gaza stiehlt.
Wie auch immer wir die Folgen des gegenwärtigen Konflikts beurteilen - Kriegsverbrechen oder Völkermord - die quälende Frage, die unter den Trümmern zum Vorschein kommt, lautet:
"Was kommt als nächstes?"
Der Nahostexperte Rob Malley, der Sondergesandte von Präsident Joe Biden für den Iran, wies auf die Sinnlosigkeit des derzeitigen Ansatzes hin. Malley erklärte gegenüber David Remnick von The New Yorker, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ein Volk hervorgebracht hat, "das alles verloren hat und nur noch Demütigung und Verlassenheit empfindet - und den heuchlerischen westlichen Moralismus verachtet. Dies wird künftige Kämpfer nähren, und wie sie sich verhalten, wird von alten Missständen und neuen Technologien geprägt sein - die Israel heute beherrscht, die aber auch sie beherrschen könnten."
Remnick schlussfolgerte: "Nach dem bekannten Muster ist der Vorsatz von heute das Pulverfass von morgen."
Zu Beginn des Konflikts haben wir darüber nachgedacht, wie schwierig es ist, Israel für die unverhältnismäßige Reaktion im Gazastreifen zur Verantwortung zu ziehen. Wir merkten an, dass wir als Katholiken "die Last des Schweigens und in einigen Fällen der Mitschuld an dem nicht quantifizierbaren Schrecken des Holocaust tragen, wenn wir moralische Fragen zu Israels Reaktion auf den Angriff stellen. ... Manchmal sind Geschwister gezwungen, schwierige Gespräche zu führen."
Es ist ein besonders düsterer Tag, wenn sich die Diskussion darum dreht, wie weit Israel mit seiner Zerstörung des Gazastreifens und seiner Bevölkerung eine moralische Grenze überschritten hat.
Originalquelle: https://www.ncronline.org/opinion/editorial-genocide-or-not-israels-relentless-attacks-gaza-cross-moral-line
Statement von
Bischof Azar zur Aushungerung des Gazastreifens durch Israel
25. Juli 2025
„Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben, und ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben...“ Matthäus 25:36-37
Die Evangelisch-Lutherische
Kirche in Jordanien und im Heiligen Land ist schockiert und bestürzt über die
Bilder, Videos und Berichte über den Massenhunger in Gaza.
Die monatelange israelische Belagerung hat verhindert, dass jegliche Hilfe nach Gaza gelangt. Jetzt wird nur ein unzureichendes Rinnsal an Hilfsgütern hineingelassen, das nur an einigen wenigen gefährlichen Verteilungsstellen verfügbar ist, die für die meisten Menschen unzugänglich sind. 113 Palästinenser, darunter 81 Kinder, sind bereits verhungert, Dutzende von ihnen allein in den letzten Tagen.
Eines von fünf Kindern ist schwer unterernährt. In der Zwischenzeit wurden über tausend Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet und Tausende weitere verletzt, während sie verzweifelt nach Hilfe für sich und ihre Familien suchten.
Zahlreiche Hilfsorganisationen, darunter die Vereinten Nationen, warnen, dass diese von Menschen verursachte Hungersnot den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Nach ihrem Besuch in Gaza in der vergangenen Woche berichteten der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. und der lateinische Patriarch Kardinal Pierbattista Pizzaballa von hungernden Menschen, die stundenlang in der Sonne warten, in der Hoffnung auf ein Stück Brot. Sie sind Augenzeugen der Tatsache, dass die Wiederaufnahme der Hilfe eine Frage von Leben und Tod.
Im Namen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land und der
weltweiten lutherischen Gemeinschaft verurteile ich diese Politik der
Ausrottung durch Aushungern auf das Schärfste. Die israelische Regierung setzt
den Hunger als Waffe ein, um ihre ethnische Säuberung der PalästinenserInnen in
Gaza zu beschleunigen.
Wir rufen die Regierungen der Welt, religiöse Führer, internationale Organisationen und alle Menschen mit Gewissen auf, alles zu tun, um diese tödliche Belagerung zu beenden und den freien Fluss der Hilfe zu ermöglichen.
Selbst jetzt lagern lebensrettende Hilfsgüter unangetastet in Lagerhäusern, nur wenige Kilometer von den Bedürftigen in Gaza entfernt. Es muss Druck auf Israel ausgeübt werden, damit Hilfsorganisationen die sichere, menschenwürdige und effektive Verteilung von Hilfsgütern wieder aufnehmen können
Wie Seine Seligkeit Theophilos III. nach seinem Besuch in Gaza sagte, ist das Schweigen angesichts des Leids ein Verrat am Gewissen. Wie Patriarch Kardinal Pizzaballa sagte, können wir nicht neutral sein.
Unser Herr Jesus lehrte uns zu beten: „Unser tägliches Brot gib uns heute“. Heute beten wir für die Menschen in Gaza, damit sie ihr tägliches Brot haben. Wir beten, dass die Hungrigen zu essen bekommen, die Durstigen Wasser und die Kranken Medizin. Wir rufen zu einem sofortigen Waffenstillstand auf, zu einem Ende dieses Völkermords und zu Gerechtigkeit für unser Land
Bischof Dr Sani Ibrahim Azar
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordan und dem Heiligen Land.
Lateinischer Patriarch von Jerusalem: Krieg in Gaza ist
"unentschuldbar
By Crux Staff
Crux, Jul 22, 2025
|Israels Vorgehen in Gaza ist nach Ansicht des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, "unentschuldbar".
Er besuchte den Gazastreifen am Freitag, einen Tag nach dem Panzerangriff auf die einzige katholische Kirche in der Region, die Pfarrei der Heiligen Familie. Bei der Explosion wurden drei Menschen getötet und mehrere andere verletzt, darunter auch der Pfarrer, Pater Gabriel Romanelli.
Gegenüber Vatican Media sagte Pizzaballa, die Bilder der angegriffenen Kirche und des Gazastreifens selbst, die ihm im Vergleich zu früheren Besuchen im Gedächtnis geblieben sind, "sind die riesigen Ausmaße der Zelte, die vorher nicht da waren".
"Als ich dort war, lebten alle im Süden, der durch den Netzarim-Korridor abgeriegelt war. Sie sind wieder nach oben gezogen, und jetzt gibt es mehr als eine Million Menschen ohne Wohnung. Vor allem entlang der Strandpromenade gibt es lange Abschnitte mit Zelten, in denen die Menschen unter äußerst prekären Bedingungen leben, sowohl in hygienischer als auch in jeder anderen Hinsicht", so der Kardinal. "Und das andere Bild ist das Krankenhaus: Die Kinder sind verstümmelt, geblendet von den Auswirkungen der Bombardierungen."
Er sprach auch mit Vatican Media über den Kirchenkomplex, in dem Hunderte von Menschen untergebracht sind, um der Gewalt des Krieges zu entgehen.
Bei seinem Besuch, nur einen Tag nach dem Panzerangriff, wurde dort eine Messe gefeiert.
"Ja, ich bin immer wieder erstaunt, muss ich sagen. Diese paar hundert Menschen sind zwar sehr gut geschützt, aber sie sind nicht von denselben Problemen ausgenommen wie alle anderen: Mangel an Lebensmitteln - sie haben seit Monaten weder Gemüse noch Fleisch gesehen - kurzum, wie alle anderen auch", so Pizzaballa.
"Aber ich sehe, auch bei Kindern, sicherlich Müdigkeit, aber auch Vitalität, Lust. Solange eine Person den Wunsch hat, etwas zu tun, sich zu verändern, bedeutet das, dass noch Leben in ihr steckt, und das habe ich bemerkt", fügte er hinzu.
Der Kardinal sagte auch, dass das palästinensische Volk im Gazastreifen bleiben wird, obwohl Israel seine Evakuierung anordnet.
"Sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen, aber sie wollen auch nicht weg, denn sie haben dort ihre Wurzeln, ihr Zuhause, oder besser gesagt, sie hatten dort ihr Zuhause und wollen es dort wieder aufbauen", sagte er und fügte hinzu, dass Papst Leo XIV. sehr deutlich gesagt habe, dass es keine Transfers von Menschen aus dem Gazastreifen geben dürfe.
"Es wird keine Rivieras in Gaza geben", sagte Pizzaballa und bezog sich damit auf die Idee von US-Präsident Donald Trump, den Gazastreifen zu entvölkern und in ein US-amerikanisches Feriengebiet zu verwandeln.
"Der Papst hat unter anderem gesagt, dass das Verbot der 'kollektiven Bestrafung' respektiert werden muss", so der Kardinal, der sagte, Leo sei sehr klar und sehr stark.
"Ich möchte eines klarstellen: Wir haben nichts gegen die jüdische Welt, und wir wollen auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass wir gegen die israelische Gesellschaft und das Judentum sind, aber wir haben die moralische Pflicht, mit absoluter Klarheit und Offenheit unsere Kritik an der Politik dieser Regierung in Gaza zum Ausdruck zu bringen", sagte Pizzaballa.
14. 7. 2025
Wir, der Rat der Patriarchen und Kirchenoberhäupter von Jerusalem, sind heute hier in Taybeh, um uns mit der örtlichen Gemeinschaft zu solidarisieren, nachdem sich der Trend zu systematischen und gezielten Angriffen gegen sie und ihre Präsenz verstärkt hat. Wir bitten um die Gebete, die Aufmerksamkeit und das Handeln der Welt, insbesondere der Christen weltweit.
Am Montag, dem 7. Juli 2025, legten radikale Israelis aus den nahe gelegenen Siedlungen absichtlich Feuer in der Nähe des Friedhofs der Stadt und der Kirche des Heiligen Georg, die aus dem 5. Taybeh ist die letzte verbliebene rein christliche Stadt im Westjordanland. Diese Handlungen stellen eine direkte und absichtliche Bedrohung für unsere lokale Gemeinschaft dar, aber auch für das historische und religiöse Erbe unserer Vorfahren und die heiligen Stätten. Angesichts solcher Bedrohungen besteht der größte Akt der Tapferkeit darin, diese Stadt weiterhin als unsere Heimat zu bezeichnen. Wir stehen zu Ihnen, wir unterstützen Ihre Widerstandskraft, und wir beten für Sie.
Wir danken den Anwohnern und den Feuerwehrleuten dafür, dass sie das Feuer gelöscht haben, bevor unsere heiligen Stätten zerstört wurden, aber wir schließen uns den Stimmen der örtlichen Priester - griechisch-orthodox, lateinisch und melkitisch-griechisch-katholisch - an, die angesichts der wiederholten, systematischen Angriffe dieser Radikalen, die immer häufiger werden, um Unter-stützung bitten.
In den letzten Monaten haben die Radikalen ihr Vieh auf die Höfe der Christen im Osten von Taybeh - dem landwirtschaftlichen Gebiet - getrieben, wodurch diese im besten Fall unzugänglich wurden, im schlimmsten Fall aber die Olivenhaine, von denen die Familien abhängig sind, beschädigt wurden. Letzten Monat wurden mehrere Häuser von diesen Radikalen angegriffen, die Feuer legten und ein Plakat aufstellten, auf dem stand: „Hier gibt es keine Zukunft für euch§.
Die Kirche ist seit fast 2.000 Jahren in dieser Region präsent. Wir weisen diese Botschaft der Ausgrenzung entschieden zurück und bekräftigen unser Engagement für ein Heiliges Land, das ein Mosaik verschiedener Religionen ist, die friedlich in Würde und Sicherheit zusammenleben.
Der Rat der Patriarchen und Kirchenoberhäupter fordert, dass diese Radikalen von den israelischen Behörden zur Rechenschaft gezogen werden, die ihre Anwesenheit in der Umgebung von Taybeh erleichtern und ermöglichen. Selbst in Zeiten des Krieges müssen heilige Stätten geschützt werden. Wir fordern eine sofortige und transparente Untersuchung der Frage, warum die israelische Polizei nicht auf die Notrufe der örtlichen Gemeinde reagiert hat und warum diese abscheulichen Aktionen weiterhin ungestraft bleiben.
Die Angriffe von Siedlern auf unsere Gemeinschaft, die in Frieden lebt, müssen aufhören, sowohl hier in Taybeh als auch anderswo im Westjordanland. Dies ist eindeutig Teil der systematischen Angriffe gegen Christen, die wir in der gesamten Region beobachten.
Darüber hinaus bitten wir Diplomaten, Politiker und Kirchenvertre-ter in aller Welt, sich im Gebet für unsere ökumenische Gemein-schaft in Taybeh einzusetzen, damit ihre Anwesenheit gesichert ist und sie in Frieden leben können, um frei zu beten, ohne Gefahr anzubauen und in einem Frieden zu leben, der viel zu knapp bemessen zu sein scheint.
Wir schließen uns unseren Glaubensbrüdern in Taybeh an und bekräftigen angesichts der anhaltenden Bedrohung die Hoffnung: „Wahrheit und Gerechtigkeit werden letztendlich siegen“. Und wir erinnern uns an die Worte des Propheten Amos, die in dieser schwierigen Zeit zu unserem Gebet werden: „Möge das Recht wie Wasser herabfließen und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegen-der Strom“.
+ Die Patriarchen und
Oberhäupter der Kirchen von Jerusalem
11. 7. 25
Der Präsident der
Spanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Luis Argüello,
warnt vor den „völkermörderischen Zügen“ des israelischen Vorgehens im
Gazastreifen.
Auch Schweigen ist nicht
akzeptabel, denn unter denen, die sich dagegen wehren, befinden sich politische
Gegner, mit denen wir niemals zusammenarbeiten dürfen. Die Verteidigung des
menschlichen Lebens und der Menschenwürde kennt keine Berechnungen.“
Argüello schließt sich dem Manifest der Plattform „Stoppt den
Krieg“ an, das von mehr als 30.000 Menschen unterzeichnet wurde, darunter
bekannte Persönlichkeiten wie Buenafuente, Almodóvar,
Miguel Ríos, Coque Malla, Javier Cercas und Rosa Montero.
11.07.2025 | Jesús Bastante
„Wir können uns nicht an den Krieg mit völkermörderischen Zügen im Gazastreifen gewöhnen .“ Der Erzbischof von Valladolid und Präsident der Spanischen Bischofskonferenz, Luis Argüello, hat Israels Vorgehen gegen die Bevölkerung des Gazastreifens angeprangert. Er steht im Einklang mit dem vor einigen Wochen von der Spanischen Bischofskonferenz verabschiedeten Text, in dem die Institution die Geschehnisse im Gazastreifen erstmals als „Völkermord“ bezeichnet hat .
Es ist nicht das erste Mal, dass der Präsident des spanischen Episkopats die Lage im Gazastreifen anprangert. Am 13. Juni veröffentlichte Argüello, ebenfalls von X aus, einen Appell zur dortigen humanitären Krise.
„Angesichts vieler Geschehnisse halten wir uns manchmal lieber die Nase zu und schauen weg. Die humanitäre Tragödie, die sich im Gazastreifen abspielt, muss uns dazu zwingen, unseren moralischen, politischen und spirituellen Druck zu verdoppeln und einen gerechten Frieden zu fordern“, sagte er im vergangenen Juni.
Bereits am 21. Mai brachte der Vorsitzende der Bischofskonferenz zum Ausdruck, dass es angesichts des Krieges im Heiligen Land „keinen Platz zum Schweigen“ gebe und rief zu einem „lauten und deutlichen“ Aufschrei gegen die humanitäre Tragödie auf, die durch die Aktionen der israelischen Regierung im Gazastreifen verursacht wurde.
24. Juni 2025
Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) hat „tiefe Trauer und Empörung“ darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Krise in Palästina und Israel ein Ausmaß erreicht hat, das in eklatanter Weise gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte sowie gegen grundlegende moralische Prinzipien verstößt.
„Wir erkennen einen klaren Unterschied zwischen dem jüdischen Volk, unseren Glaubensgeschwistern, und den Handlungen der israelischen Regierung und bekräftigen, dass der ÖRK entschieden gegen jede Form von Rassismus, einschließlich Antisemitismus, antiarabischem Rassismus und Islamfeindlichkeit, steht“, heißt es in einer Erklärung des Leitungsgremiums des ÖRK. „Das unerträgliche Leid, das den Menschen in Gaza zugefügt wird, und die eskalierende Gewalt und Unterdrückung im Westjordanland und in Jerusalem zwingen die weltweite Gemeinschaft der Kirchen jedoch, sich klar, eindringlich und engagiert für die Grundsätze der Gerechtigkeit gemäß dem Völkerrecht und der Ethik auszusprechen.“
Der ÖRK bekräftigte sein langjähriges Engagement für den interreligiösen Dialog und die Zusammenarbeit sowie für das Völkerrecht als Rahmen für Frieden, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht.
Die Erklärung fordert, die Realität der Apartheid beim Namen zu nennen. „Wir erkennen das von Israel gegen das palästinensische Volk verhängte Apartheid-System an, das gegen das Völkerrecht und das moralische Gewissen verstößt, und verurteilen es“, heißt es in dem Text
Die Erklärung fordert die Umsetzung von Sanktionen und Rechenschaftspflicht. „Wir rufen Staaten, Kirchen und internationale Institutionen dazu auf, Konsequenzen für Verstöße gegen das Völkerrecht zu verhängen, darunter gezielte Sanktionen, Desinvestitionen und Waffenembargos“, heißt es in dem Text. „Die Internationale Strafgerichtshof und die Mechanismen der Vereinten Nationen, die mögliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen, müssen uneingeschränkt unterstützt werden.“
Die Erklärung bekräftigt auch die Rechte und die Freiheit, Gerechtigkeit, Rückkehr und Selbstbestimmung der Palästinenser. „Wir fordern die Beendigung der Besatzung und die Aufhebung der rechtswidrigen Blockade des Gazastreifens“, heißt es in dem Text.
Abschließend ruft die Erklärung dazu auf, die Widerstandsfähigkeit und das Zeugnis der palästinensischen christlichen Kirchen und Gemeinden zu unterstützen und „ihr Recht, auf ihrem Land zu bleiben und ihren Glauben frei auszuüben, zu wahren“.
Die Erklärung schließt mit einem Lob für die Führung der südafrikanischen Regierung, die sich vor dem Internationalen Gerichtshof für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht nach internationalem Recht einsetzt, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Urteilen des Gerichtshofs nachzukommen. „Die Kirchen weltweit sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen, ihre Stimme zu erheben und zu handeln“, heißt es abschließend in der Erklärung.
Der Zentralausschuss des
ÖRK tagte vom 18. bis 24. Juni in Johannesburg, Südafrika.
Link zur Resolution auf
Englisch:
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-palestine-and-israel-a-call-to-end-apartheid-occupation-and-impunity-in-palestine-and-israel?fbclid=IwY2xjawLfi31leHRuA2FlbQIxMQABHlX3GY08OaGQZ7rkcLo-lIfyYDJmDPAVDbYwr3NYztZT2uKxVrWQSfvsq1do_aem_dFSUJEmB6o1H_ropH3kNsw
10. 6. 25
VATIKANSTADT (RNS) - Papst Franziskus hat jeden Abend in
der Kirche der Heiligen Familie in Gaza angerufen.
June 10, 2025
VATIKANSTADT (RNS) - In einer aufgezeichneten Botschaft sprach der Pfarrer der einzigen katholischen Kirche in Gaza über die Kämpfe der rund 500 Flüchtlinge, die dort Zuflucht gefunden haben, darunter 50 Kinder, während die Hoffnung angesichts der anhaltenden Bombardierungen durch die israelischen Streitkräfte schwindet.
"Solange die Bombardierungen andauern, wird sich die Situation leider weiter verschlimmern", sagte der Pfarrer der Gaza-Gemeinde, Gabriel Romanelli, und fügte hinzu, dass jede Bombe "mehr Tote, mehr Verletzte, mehr Zerstörung und weniger Hoffnung aus humanitärer Sicht" bedeutet.
Die aufgezeichneten Äußerungen Romanellis wurden am Dienstag (10. Juni) bei einem Treffen italienischer Journalisten in Ascoli Piceno, Italien, mitgeteilt. Papst Franziskus rief jeden Abend um 20 Uhr in der Gaza-Gemeinde an, auch während seines Krankenhausaufenthalts im Gemelli-Krankenhaus in Rom, und rückte die Kirche damit ins internationale Rampenlicht. Die Pfarrei läutet ihre Glocken weiterhin zur gleichen Stunde, um an diese Anrufe zu erinnern, die liebevoll als "Papststunde" bezeichnet werden.
Christen und Muslime aller Altersgruppen finden in der Pfarrei Zuflucht, die sich in ein Zuhause und eine Zuflucht vor dem Krieg zwischen Israel und Hamas verwandelt hat. Aus den ehemaligen Klassenzimmern sind Schlafräume geworden, in denen 10 bis 15 Menschen untergebracht sind, "die alles verloren haben - ihre Familien, ihre Lieben, ihr Haus, ihre Schulen, ihren Arbeitsplatz. Die Situation ist schrecklich", sagte der Priester.
Romanelli, der aus Buenos Aires, Argentinien, stammt, sagte, dass die mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen "keine Zukunft sehen", weil "es kein klares Signal gibt, dass sie leben und ihr Leben wieder aufbauen können".
"Jeder braucht ein Ende", fügte er hinzu.
Der Priester, der Medienberichten zufolge auch gegen Krebs kämpft, sagte, die Menschen in Gaza bräuchten dringend Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Er erklärte, dass Fleisch schwer zu finden sei und die Lebensmittelpreise exponentiell gestiegen seien, so dass selbst Gemüse für die meisten unerschwinglich geworden sei. Die Banken im Gaza-Streifen seien seit 20 Monaten geschlossen, und Zucker werde jetzt löffelweise verkauft.
Das Patriarchat von Jerusalem, das die katholischen Gemeinden im Heiligen Land unterstützt, stellt der Gemeinde einige Dosen des begehrten Mehls zum Brotbacken zur Verfügung. "Wir sieben das Mehl schon seit Monaten", sagt Romanelli und erklärt, dass das Mehl so voller Würmer ist, dass es zwei- oder dreimal gesiebt werden muss.
Israel hat die Einfuhr von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen blockiert, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im vergangenen Monat angekündigt hatte, die Belagerung der Region aufzuheben. Ein Boot mit Aktivisten, die Hilfsgüter nach Gaza brachten, darunter auch Greta Thunberg, wurde am Montag abgefangen. Nachrichtenberichten zufolge schossen die israelischen Streitkräfte auch in der Nähe eines Zentrums zur Verteilung von Hilfsgütern.
Vor seinem Tod ordnete Papst Franziskus an, dass das Papamobil, mit dem er 2014 in Bethlehem unterwegs war, in eine mobile medizinische Einheit für Gaza umgewandelt wird. Nach Angaben der katholischen Hilfsorganisation Caritas Jerusalem durfte das Fahrzeug jedoch nicht in den Gazastreifen einfahren.
"Wir haben weiterhin ein starkes geistliches Leben", sagte Romanelli und fügte hinzu, dass in der Kirche Meditationen, Gebete und der Rosenkranz abgehalten werden. Nach den Gebeten werden die Kinder ermutigt, nach draußen zu gehen und zu spielen, aber sie laufen wieder hinein, wenn sie Flugzeuge über sich hören, weil sie Angst vor Bomben oder Granatsplittern haben. "Dann sind alle wieder draußen", so Romanelli. "Man gewöhnt sich daran."
Trotz der Schwierigkeiten sagte der Priester, dass es den Bewohnern der Gemeinde "gut geht", und er bat die Menschen "zu beten, für den Frieden zu arbeiten und die Menschen davon zu überzeugen, dass Frieden möglich ist".
Papst Leo XIV. rief in seiner ersten Sonntagsansprache als Papst zu einem Waffenstillstand in den Konfliktgebieten der Welt auf, darunter auch im Gazastreifen, und appellierte später an "den Zugang zu humanitärer Hilfe in Würde und die Beendigung der Feindseligkeiten, deren herzzerreißender Preis von Kindern, alten und kranken Menschen gezahlt wird".
Leo hat die schwierige Aufgabe, über die Beziehungen zu Israel zu verhandeln, die im letzten Jahr des Pontifikats von Franziskus aufgrund der kritischen Äußerungen des verstorbenen Papstes zur israelischen Offensive in Gaza angespannt waren.
Where will Pope Leo lead the church? Look for clues in his
first speeches
Thomas Reese
National Catholic Reporter, May 28, 2025
Es ist noch früh im
Pontifikat von Papst Leo XIV., und bisher erweisen sich seine Worte und Taten
als Rorschach-Test, wobei ihre Interpretationen mehr über die Kommentatoren als
über den Papst selbst aussagen.
Die Konservativen freuen
sich, dass er bei seinem ersten Auftritt auf dem Balkon des Petersdoms die
Stola und die rote Mozzetta von Papst Benedikt XVI. trug. Leo hat sogar nette
Dinge zu den Mitgliedern der vatikanischen Kurie gesagt, die Papst Franziskus
oft getadelt hat. Die Worte des neuen Papstes, die die Einheit der Kirche
unterstützen, sind in ihren Ohren angenehm.
Die Liberalen freuen sich,
dass er den Namen Leo gewählt hat, in Anlehnung an Leo XIII., den Begründer der
katholischen Soziallehre im 19. Er hat sich auch positiv auf seinen Vorgänger
Franziskus berufen.
Wer also ist Leo und wohin
wird er die Kirche führen? Wird er die Reformen von Franziskus rückgängig
machen? Den Pausenknopf drücken? Oder wird Leo über das hinausgehen, wo
Franziskus bereit war zu gehen? Es lohnt sich, die ersten Reden des neuen
Papstes zu analysieren, um Hinweise zu erhalten.
In seiner ersten Ansprache
vom Balkon des Petersdoms am 8. Mai sagte Leo, die Kardinäle hätten ihn dazu
auserwählt, „der Nachfolger Petri zu sein und mit euch als geeinte Kirche zu
gehen, die immer nach Frieden und Gerechtigkeit strebt, die immer danach strebt,
als Männer und Frauen zu handeln, die Jesus Christus treu sind, um das
Evangelium ohne Furcht zu verkünden und zu missionieren“.
Das bedeutet, dass Leo
glaubt, dass eine geeinte Kirche, die Jesus Christus treu ist, für den Auftrag
der Kirche, das Evangelium zu verkünden und sich um Frieden und Gerechtigkeit
zu bemühen, wesentlich ist.
Er sagte, er sehe die Kirche
von Rom als „eine missionarische Kirche, eine Kirche, die Brücken baut und zum
Dialog ermutigt, eine Kirche, die immer bereit ist, wie dieser Platz mit seinen
offenen Armen all jene aufzunehmen, die unserer Nächstenliebe, unserer Präsenz,
unserer Bereitschaft zum Dialog und unserer Liebe bedürfen“.
Er wünscht sich auch „eine
synodale Kirche, eine Kirche, die vorwärts geht, eine Kirche, die immer den
Frieden sucht, die immer die Nächstenliebe sucht, die immer vor allem denen
nahe sein will, die leiden“, sagte er.
All diese Themen - Frieden,
Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Dialog, Brückenbau, Aufnahme und Synodalität -
stehen im Einklang mit der Politik von Franziskus, dessen „mutige Stimme“ Leo
anrief, als er Rom und die ganze Welt mit der Liebe Gottes segnete. Leo mag
nicht die Kleider von Benedikt getragen haben, aber seine Worte reimten sich
auf die von Franziskus.
In seiner ersten Ansprache an das Kardinalskollegium am 10. Mai praktizierte Papst Leo, was er predigte, indem er zunächst eine kurze Ansprache hielt und dann einen Dialog führte, bei dem die Kardinäle ihm „Ratschläge, Anregungen, Vorschläge, konkrete Dinge“ geben konnten. Hier übte er jedoch die Synodalität in einem Forum ohne Laien aus, das für die Konservativen akzeptabel wäre. Er bezeichnete die Kardinäle als seine „engsten Mitarbeiter", was unter Franziskus nicht der Fall war, der sich fast nie mit dem Kollegium als Gruppe beraten hat.
In seiner ersten Ansprache an das Kardinalskollegium am 10. Mai praktizierte Papst Leo, was er predigte, indem er zunächst eine kurze Ansprache hielt und dann einen Dialog führte, bei dem die Kardinäle ihm „Ratschläge, Anregungen, Vorschläge, konkrete Dinge“ geben konnten. Hier übte er jedoch die Synodalität in einem Forum ohne Laien aus, das für die Konservativen akzeptabel wäre. Er bezeichnete die Kardinäle als seine „engsten Mitarbeiter“, was unter Franziskus nicht der Fall war, der sich fast nie mit dem Kollegium als Gruppe beraten hat.
Franziskus zog die Abhaltung
von Synoden den außerordentlichen Konsistorien vor, bei denen alle Kardinäle
nach Rom einberufen werden, um den Papst zu beraten. Wird Leo die Konsistorien
als Form der Beratung wieder einführen oder wird er sich nur auf Synoden
verlassen, wie es Franziskus tat?
In seiner kurzen Ansprache bezeichnete
Leo den Papst als „einen demütigen Diener Gottes und seiner Brüder und
Schwestern, und nichts anderes“. Dies entspricht auch der Auffassung von
Franziskus, dass Bischöfe und Priester Diener des Volkes Gottes sind, nicht
Herren.
Insgesamt berief sich Leo fünfmal auf Franziskus und lobte ihn für seine „vollkommene Hingabe an den Dienst und die nüchterne Einfachheit des Lebens, seine Hingabe an Gott während seines gesamten Dienstes und sein gelassenes Vertrauen im Augenblick seiner Rückkehr ins Haus des Vaters“.
„Nehmen wir dieses kostbare
Erbe an“, sagte er zu den Kardinälen, „und setzen wir den Weg fort, beseelt von
derselben Hoffnung, die aus dem Glauben geboren wird.“
Leo wies auf das Apostolische
Schreiben Evangelii Gaudium von Franziskus hin, aus dem er „einige grundlegende
Punkte hervorhob: die Rückkehr zum Primat Christi in der Verkündigung (vgl. Nr.
11); die missionarische Bekehrung der gesamten christlichen Gemeinschaft (vgl.
Nr. 9); das Wachstum von Kollegialität und Synodalität (vgl. Nr. 33); die
Beachtung des sensus fidei (vgl. Nr. 33). Nr. 119-120), vor allem in seinen
authentischsten und umfassendsten Formen, wie der Volksfrömmigkeit (vgl. Nr.
123); die liebevolle Sorge für die Geringsten und die Ausgestoßenen (vgl. Nr.
53); der mutige und vertrauensvolle Dialog mit der Welt von heute in ihren
verschiedenen Bestandteilen und Realitäten (vgl. Nr. 84; Zweites Vatikanisches
Konzil, Pastoralkonstitution Gaudium et spes, 1-2)!.
Dies war eine
uneingeschränkte Anerkennung des Erbes von Franziskus.
Leo argumentierte, dass dies
„evangelische Prinzipien sind, die das Leben und Handeln der Familie Gottes
immer inspiriert und geleitet haben“.
Unter Berufung auf Franziskus
und Benedikt erklärte er: "In diesen Werten hat sich das barmherzige
Antlitz des Vaters offenbart und offenbart sich weiterhin in seinem
menschgewordenen Sohn, der letzten Hoffnung aller, die aufrichtig nach
Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit suchen (vgl. Benedikt XVI.,
Spe Salvi, 2; Franziskus, Spes Non Confundit, 3)."
In einer weiteren Ansprache
am Samstag, dem 24. Mai, wandte sich der Papst an die Mitarbeiter des Heiligen
Stuhls und des Staates Vatikanstadt. Er dankte ihnen für ihren Dienst und
stellte fest, dass „Päpste gehen, die Kurie bleibt“.
Leo, als ehemaliges Mitglied der Kurie, hat eine positivere Sichtweise als Franziskus. „Die Kurie ist die Institution, die das historische Gedächtnis des Papsttums bewahrt und weitergibt“, sagte er. Dieses Gedächtnis „ist nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet, sondern nährt die Gegenwart und leitet die Zukunft. Ohne Erinnerung geht der Weg verloren, verliert er seine Richtung“.
In der Nachfolge von
Franziskus betonte Leo jedoch die missionarische Dimension der Kurie. Er
wiederholte, was er an seinem ersten Tag als Papst gesagt hatte: „Gemeinsam
müssen wir nach Wegen suchen, um eine missionarische Kirche zu sein, eine
Kirche, die Brücken baut und den Dialog fördert, eine Kirche, die immer offen
ist, um all jene mit offenen Armen aufzunehmen, die unsere Nächstenliebe,
unsere Anwesenheit, unsere Bereitschaft zum Dialog und unsere Liebe brauchen.“
Obwohl er sanfter ist als
Francis, weist er dennoch auf Bereiche hin, die verbessert werden müssen.
„Wir müssen alle an der
großen Sache der Einheit und der Liebe mitarbeiten“, sagte er. „Versuchen wir,
dies in erster Linie durch unser Verhalten in alltäglichen Situationen zu tun,
auch in der Arbeitswelt. Jeder kann mit seinem Verhalten gegenüber den Kollegen
ein Baumeister der Einheit sein, indem er unvermeidliche Missverständnisse mit
Geduld und Demut überwindet, sich in die Lage des anderen versetzt, Vorurteile
vermeidet und auch mit einer guten Dosis Humor, wie Papst Franziskus uns
gelehrt hat.
Bisher folgt Leo dem Weg von
Franziskus, aber er hat es vermieden, sich in einer Weise zu äußern, die sowohl
auf der rechten als auch auf der linken Seite Kontroversen auslösen würde. Er
hat es vermieden, sich zu kontroversen Themen wie LGBTQ-Katholiken, der
traditionellen lateinischen Messe und weiblichen Diakonen zu äußern, die für
verschiedene Teile der Kirche ein gefundenes Fressen wären. Aber wie lange er
das durchhalten kann, bleibt abzuwarten.
Vielleicht spiegelt die
positive Reaktion auf Leo aus verschiedenen Fraktionen der Kirche seinen Wunsch
wider, ein Brückenbauer zu sein, eine Quelle der Einheit. Bislang ist er damit
erfolgreich. Fast alle scheinen ihn zu umarmen.
In Anlehnung an den heiligen Augustinus
scheint Leo die Einheit nicht so zu sehen, dass alle denselben Ton singen,
sondern eher als einen Chor, der in Harmonie singt. Letztendlich wird der
Chorleiter jedoch einige Anweisungen geben müssen. Einige werden aufgefordert
werden, lauter zu singen, andere leiser. Einigen wird man sagen, dass sie nicht
richtig singen, während andere als Solisten ausgewählt werden. Das wird einige
im Chor verärgern, egal wie sanft der Chorleiter versucht, zu sein.
Das Erbe von Franziskus und die
Herausforderungen von Papst Leo XIV.
Das Szenario, das der neue Papst Robert Francis Prevost übernimmt, ist alles andere als friedlich. Die katholische Kirche steht vor zahlreichen internen und externen Herausforderungen, die diplomatisches Geschick, pastoralen Mut und die Fähigkeit zum Dialog mit der heutigen unruhigen Welt erfordern.
Unter dem Pontifikat von Franziskus haben die Spannungen zwischen konservativen und progressiven Sektoren innerhalb der Kirche zugenommen. Die zunehmende Polarisierung in der Welt ist auch in Peters Boot spürbar. Kritik an seinem pastoralen Stil und seinen Reformen kam von einflussreichen Kardinälen, Laiengruppen und Theologen. Diese Aufteilung spiegelt die politische und kulturelle Vielfalt wider, die die globale Situation kennzeichnet. Papst Leo XIV. wird die schwierige Aufgabe haben, die Einheit der Kirche zu bewahren, ohne die Vielfalt der katholischen Ausdrucksformen zu unterdrücken.
Die Tatsache, dass er den Namen Leo in Anlehnung an Leo XIII. (1810–1903) annahm, jenen Papst, dessen Enzyklika „Rerum Novarum“ sich erstmals mit der Frage der Arbeitsbeziehungen befasste, zeugt von seiner Sensibilität für soziale Fragen. Man sollte auch bedenken, dass Prevost ein Augustiner war, ein Schüler des Heiligen Augustinus, eines heidnischen Philosophen, der zum christlichen Glauben konvertierte und zu einer Säule der Theologie wurde. Ein Großteil seiner priesterlichen und bischöflichen Tätigkeit fand in Peru statt, weshalb er als der zweite lateinamerikanische Papst gelten kann.
Der Mangel an Priesterberufungen, insbesondere in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent, bedroht jedoch vielerorts die pastorale Nachhaltigkeit der Kirche. Gleichzeitig erschweren die Überalterung des Klerus und die Überlastung der Seelsorge die wirksame Präsenz der Kirche in zahlreichen Gemeinden. Dies eröffnet erneut Debatten über den optionalen Zölibat, die Ordination von Frauen und das Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf das Sakrament der Ehe.
Nach zwölf Jahren Pontifikat hat Papst Franziskus der katholischen Kirche und im weltweiten Kontext ein bemerkenswertes Erbe hinterlassen, sowohl hinsichtlich seines pastoralen Ansatzes als auch hinsichtlich seiner Positionen zu zeitgenössischen Problemen. Jorge Mario Bergoglio war der erste lateinamerikanische Papst, der erste Jesuit im Amt und der erste, der den Namen Franziskus annahm – in Anlehnung an den Heiligen Franz von Assisi. Er führte die Kirche durch turbulente Zeiten, die von inneren Krisen und tiefgreifenden sozialen, politischen und ökologischen Veränderungen geprägt waren.
Seit seiner Wahl im Jahr 2013 strebt Franziskus eine Kirche an, die den Ausgeschlossenen und der realen Welt näher steht. Die bevorzugte Option für die Armen, die Bewahrung der Schöpfung, die Kritik an der Wegwerfkultur und die Verteidigung der Migranten waren Markenzeichen. Enzykliken wie „Laudato Si‘“ (2015) über ganzheitliche Ökologie und „Fratelli Tutti“ (2020) über universelle Brüderlichkeit zeigten einen Papst mit globaler Sensibilität und Bewusstsein für die ethischen Herausforderungen der heutigen Zeit.
In der Kirche förderte er bedeutende Reformen in der römischen Kurie, strebte nach größerer finanzieller Transparenz, bestrafte einen korrupten Kardinal und vereinfachte die Verwaltungsstrukturen. Er nahm eine eher pastorale Haltung zu sensiblen Themen wie Homosexualität, geschiedenen und wiederverheirateten Menschen und der Rolle der Frau in der Kirche ein, hielt jedoch in vielen Aspekten an der traditionellen Lehre fest. Sein direkter und unprätentiöser Stil, verbunden mit seinem Engagement für die Barmherzigkeit, hat das Bild der Kirche für viele Gläubige neu belebt.
Trotz der Bemühungen von Franziskus, die Präsenz der Frauen in der Kirche zu erhöhen, werden die Forderungen nach einer stärkeren Rolle der Frauen immer lauter. Die Ernennung von Frauen in Positionen der römischen Kurie und die Einrichtung von Kommissionen zur Untersuchung des weiblichen Diakonats sind wichtige, aber unzureichende Schritte. In der Kirche ist die Frauenfeindlichkeit sehr stark ausgeprägt. Der neue Pontifex wird zunehmendem Druck ausgesetzt sein, in diesem Bereich konkrete Fortschritte zu erzielen, auch im Hinblick auf doktrinäre und ekklesiologische Implikationen. Konservative hingegen werden ihre alten Argumente herausposaunen, dass Jesus ein Mann gewesen sei und dass es in der Gruppe der Zwölf keine „weiblichen Apostel“ gegeben habe …
Der Skandal um sexuellen Missbrauch ist weiterhin eine offene Wunde in der Kirche. Franziskus hat wichtige Schritte unternommen, um das Problem anzugehen – etwa das Motu proprio „Vos Estis Lux Mundi“ –, aber es gibt immer noch institutionellen Widerstand und Versäumnisse. Leo XIV. muss eine strenge Politik der Prävention, Bestrafung und Unterstützung der Opfer beibehalten und vertiefen.
Die multipolare und fragmentierte Welt braucht eine spirituelle Führung, die in der Lage ist, Brücken zu bauen – das ist die Bedeutung des Wortes „Papst“. Das Pontifikat von Franziskus war geprägt durch seinen Dialog mit dem Islam, dem Judentum und anderen religiösen Traditionen sowie durch seine Aufrufe zum Frieden in Konflikten wie denen in Syrien, der Ukraine und Israel. Prevost muss diese diplomatische und moralische Rolle in einem globalen Szenario pflegen, das von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Kriegen und Klimawandel geprägt ist.
Die vielleicht größte Herausforderung für den neuen Papst wird darin bestehen, die Vitalität der Missionsmission in einer zunehmend säkularisierten Welt aufrechtzuerhalten. Die Kirche muss eine Sprache, Haltung und Strukturen finden, die die Herzen der Menschen von heute ansprechen, insbesondere der jungen Menschen. Dies erfordert pastorale Kreativität, Offenheit für Synodalität – ein Prozess, den Franziskus bereits begonnen hat – und Mut, Formen der Präsenz und des Handelns in der digitalen Welt, in städtischen Randgebieten und in multikulturellen Kontexten zu überdenken.
Ich denke, dass das bedeutendste Erbe von Franziskus der Versuch ist, der Kirche wieder ein Gesicht der Zärtlichkeit, Einfachheit und des Dialogs zu verleihen. In Zeiten der Autoritätskrise und des Vertrauensverlusts in Institutionen beharrte er auf der Barmherzigkeit als Namen Gottes. Leo XIV. wird nicht bei Null anfangen – er wird das Zeugnis eines Hirten vor Augen haben, der trotz seiner Grenzen versucht hat, dem Evangelium inmitten der Widersprüche des 21. Jahrhunderts treu zu bleiben.
Frei Betto ist Schriftsteller und
Autor von „ Militant
Jesus – Evangelium und das politische Projekt des Königreichs Gottes “
(Vozes) und anderen Büchern.
Papst Franziskus ist kein Name, sondern ein kirchliches Projekt
Leonardo Boff
Jeder Standpunkt ist die Sicht von einem Punkt aus, sagte ich einmal. Mein
Standpunkt zu Papst Franziskus ist der eines Lateinamerikaners. Papst
Franziskus selbst stellte sich als „derjenige vor, der vom Ende der Welt
kommt“, also aus Argentinien, aus dem äußersten Süden der Welt. Diese Tatsache
ist nicht ohne Bedeutung, da sie uns eine andere Lesart als andere, aus anderen
Blickwinkeln, bietet.
Die Wahl des Namens Francisco ohne Vorläufer ist kein Zufall. Franz von Assisi
stellt ein weiteres Projekt der Kirche dar, dessen zentrale Bedeutung im
historischen Jesus lag, dem Armen, dem Freund der Verachteten und Erniedrigten
wie den Aussätzigen, mit denen er lebte. Dies ist die Perspektive, die
Bergoglio einnahm, als er zum Papst gewählt wurde. Er will eine arme Kirche für
die Armen. Folglich legte er die Ehrengewänder ab, die Tradition der römischen
Kaiser, die gut durch die Mozzetta repräsentiert wurde , jenen
kleinen weißen, mit Juwelen geschmückten Umhang, Symbol der absoluten Macht der
Kaiser und integriert in die päpstlichen Gewänder. Er lehnt es ab und gibt es
der Sekretärin als Andenken. Er trägt einen einfachen weißen Umhang mit dem
Eisernen Kreuz, das er immer trug. Er lebte in größter Einfachheit (der Papst
trägt keine Prada) und brach ohne Zeremoniell Riten, um den Gläubigen nahe sein
zu können. Dies hat sicherlich viele Mitglieder der alten europäischen
Christenheit schockiert, die an den Prunk und Glanz der päpstlichen Gewänder
und der Prälaten der Kirche im Allgemeinen gewöhnt waren. Man sollte nicht
vergessen, dass derartige Traditionen auf die Zeit der römischen Kaiser
zurückgehen, aber nichts mit den armen Handwerkern und Bauern des
Mittelmeerraums in Nazareth zu tun haben.
Überraschenderweise stellt er sich zunächst als örtlicher Bischof von Rom vor.
Dann müsse er als Papst die Universalkirche beseelen, und zwar, wie er betonte,
nicht mit kanonischem Recht, sondern mit Liebe.
Er wählte den Namen Franziskus, weil der Heilige Franz von Assisi „das Beispiel
par excellence für Fürsorge und eine ganzheitliche Ökologie ist, die mit Freude
und Authentizität gelebt wird ( Laudato Sì, Nr. 10) und alle
Wesen mit den liebevollen Namen Bruder und Schwester ansprach.“
Ich wollte nicht in einem Papstpalast wohnen, sondern in einem Gästehaus in
Santa Marta. Er aß wie alle anderen in der Schlange und kommentierte mit Humor:
„So können sie mich nicht so leicht vergiften.“
Im Mittelpunkt ihrer Mission stand die Bevorzugung und Betreuung der Armen,
insbesondere der Migranten. Er sagte ehrlich: „Ihr Europäer wart zuerst da,
habt ihr Land und ihren Reichtum besetzt und wurdet gut aufgenommen. Jetzt sind
sie hier und wollen euch nicht aufnehmen.“ Mit Trauer beobachten wir die
Globalisierung der Gleichgültigkeit.
Zum ersten
Mal in der Geschichte des Papsttums hat Papst Franziskus mehrfach globale
soziale Bewegungen empfangen. Er sah in ihnen die Hoffnung auf eine Zukunft für
die Erde, weil sie sorgsam mit ihr umgehen, Agrarökologie betreiben und in
einer volkstümlichen und partizipativen Demokratie leben. Er wiederholte ihnen
oft die Rechte, die ihnen verwehrt bleiben, die berühmten drei Ts: Land, Dach
und Arbeit. Sie müssen dort beginnen, wo sie sind: in der Region, denn dort
kann eine nachhaltige Gemeinschaft aufgebaut werden. Dies legitimierte eine
ganze globale Bewegung, den Bioregionalismus, als einen Weg zur Überwindung der
Ausbeutung und Anhäufung durch die Wenigen und zur Schaffung größerer Teilhabe
und sozialer Gerechtigkeit für die Vielen.
In diesem Zusammenhang verfasste er zwei außergewöhnliche Enzykliken: „ Laudato
si: Über die Sorge für das gemeinsame Haus “ (2020) über eine
ganzheitliche Ökologie, die Umwelt, Politik, Wirtschaft, Kultur, Alltag und
ökologische Spiritualität einbezieht. In der anderen Ausgabe, in Fratelli
tutt i (2025), spricht er angesichts der weitverbreiteten Zerstörung
der Ökosysteme die eindringliche Warnung aus: „Wir sitzen im selben Boot:
Entweder retten wir uns alle selbst, oder niemand wird gerettet“ (Nr. 34). Mit
diesen Texten stellt sich der Papst an die Spitze der globalen ökologischen
Diskussion, die über eine einfache grüne Ökologie und andere Produktionsformen
hinausgeht, ohne jemals das kapitalistische System in Frage zu stellen, dessen
Logik auf der einen Seite Akkumulation auf Kosten der Ausbeutung der großen
Mehrheit auf der anderen Seite schafft.
Papst Franziskus entstammt der argentinischen Befreiungstheologie, die die
Unterdrückung des Volkes und die Unterdrückung der Populärkultur betont. Er war
ein Schüler des Befreiungstheologen Juan Carlos Scannone, den er sogar in einer
Fußnote zu Laudato Si erwähnte. Als Student und von dieser
Theologie inspiriert, gab er sich selbst ein Versprechen: jede Woche allein die
Favelas („Villas Miseria“) zu besuchen. Er betrat die Häuser, erfuhr von den
Problemen der Armen und gab allen Hoffnung. Jahrelang gab es Kontroversen mit
der Regierung, die Sozialhilfe und Paternalismus als staatliche Politik
umsetzte. Er beklagte sich: Auf diese Weise würden die Armen nie aus der
Abhängigkeit befreit. Was wir brauchen, ist soziale Gerechtigkeit, die Wurzel
der wahren Befreiung der Armen. Aus Solidarität mit den Armen lebte er in einer
kleinen Wohnung, kochte sein eigenes Essen und holte seine eigene Zeitung. Er
weigerte sich, im Palast zu wohnen und das Sonderauto zu benutzen.
Diese befreiende Inspiration erhellte das Kirchenmodell, das er aufbauen
wollte. Keine Kirche, die sich wie eine Burg abschottet und sich vorstellt, sie
sei von allen Seiten von Feinden umgeben, die aus der Moderne mit ihren
Eroberungen und Freiheiten stammen. Dieser geschlossenen Kirche
stellte er eine Kirche entgegen, die auf existenzielle
Bedürfnisse ausgerichtet war , eine Kirche wie ein Feldlazarett, die
alle Verwundeten aufnahm, ohne sie nach ihrer sexuellen Orientierung, Religion
oder Weltanschauung zu fragen: Es genügte, dass sie Menschen in Not waren.
Papst Franziskus präsentiert sich nicht als Lehrer des Glaubens, sondern als
Seelsorger, der die Gläubigen begleitet. Er fordert die Hirten auf, den Geruch
der Schafe wahrzunehmen, denn so groß ist ihre Nähe und Hingabe zu den
Gläubigen, und sie sollen eine Pastoral der Zärtlichkeit und Liebe ausüben.
Vielleicht hat kein Papst in der Geschichte der Kirche so viel Mut gezeigt wie
er bei der Kritik am gegenwärtigen System, das tötet und zwei grausame
Ungerechtigkeiten hervorbringt: ökologische Ungerechtigkeit, die die Ökosysteme
zerstört, und soziale Ungerechtigkeit, die die Menschheit bis zum Blutvergießen
ausbeutet. Noch nie in der Geschichte hat sich der Reichtum in den Händen
weniger so stark angesammelt. Acht Einzelpersonen besitzen mehr Vermögen als
4,7 Milliarden Menschen. Es ist ein Verbrechen, das zum Himmel schreit, den
Schöpfer beleidigt und seine Söhne und Töchter opfert.
Da er eher ein Seelsorger denn ein Arzt ist, basiert seine Botschaft
insbesondere auf dem historischen Jesus, dem Freund der Armen, der Kranken, der
Ausgegrenzten und der Unterdrückten. Er wurde in einem doppelten Prozess am
Kreuz ermordet: zum einen aus religiösen Gründen (Verstöße gegen die Religion
der Zeit und sein Anspruch, sich als Sohn Gottes zu fühlen) und zum anderen aus
politischen Gründen durch die römischen Besatzungstruppen.
Er legte
keinen großen Wert auf die Lehren, Dogmen und Riten, die er stets respektierte,
da er erkannte, dass solche Dinge das menschliche Herz nicht erreichen. Dazu
braucht es Liebe, Zärtlichkeit und Barmherzigkeit. Einer der wichtigsten Sätze
seiner Lehre sagte er einmal: „Christus ist gekommen, um uns zu lehren, wie wir
leben sollen: bedingungslose Liebe, Solidarität, Mitgefühl und Vergebung,
Werte, die den Plan des Vaters ausmachen, der den Kern der Verkündigung Jesu
bildet: das Reich Gottes.“ Er zieht einen Atheisten, der ein Gespür für soziale
Gerechtigkeit hat, einem Gläubigen vor, der zwar in die Kirche geht, aber keine
Rücksicht auf seine leidenden Mitmenschen nimmt.
Ein wiederkehrendes Thema seiner Predigten ist die Barmherzigkeit. Für Papst
Franziskus ist Barmherzigkeit von wesentlicher Bedeutung. Die Verdammnis gilt
nur für diese Welt. Gott kann keinen Sohn und keine Tochter verlieren, die er
aus Liebe erschaffen hat. Die Barmherzigkeit besiegt die Gerechtigkeit und
niemand kann der göttlichen Barmherzigkeit Grenzen setzen. Er warnte die
Prediger vor dem, was seit Jahrhunderten getan wurde: Angst zu predigen und
Schrecken vor der Hölle zu verbreiten. Jeder Mensch, egal wie schlecht er war,
steht unter dem Regenbogen der Gnade und der göttlichen Barmherzigkeit.
Logischerweise ist nicht alles auf dieser Welt sein Geld wert. Doch diejenigen,
die ihr Leben lang andere Leben geopfert und sich wenig um Gott gekümmert oder
ihn sogar verleugnet haben, werden die Heilungsklinik der Gnade durchlaufen, wo
sie ihre bösen Taten erkennen und lernen, was Liebe, Vergebung und
Barmherzigkeit sind. Erst dann wird sich Gottes Klinik öffnen, die nicht der
Vorraum der Hölle, sondern der Vorraum des Himmels ist, damit auch sie an den
göttlichen Verheißungen teilhaben können.
Mit seinem Aufruf zum Handeln zugunsten der Armen, mit seiner mutigen Kritik am
gegenwärtigen System, das Tod hervorbringt und die ökologischen
Lebensgrundlagen bedroht, mit seiner leidenschaftlichen Liebe und Sorge für die
Natur und das Gemeinsame Haus, mit seinem unermüdlichen Einsatz, um des
Friedens willen in Kriegen zu vermitteln, trat er als großer Prophet hervor,
der verkündete und anprangerte, aber immer die Hoffnung weckte, dass wir eine
andere und bessere Welt aufbauen können. Damit galt er als ein von allen
respektierter und bewunderter religiöser und politischer Führer.
Unvergesslich ist das Bild eines Papstes, der allein im leichten Regen über den
Petersplatz zur Gebetskapelle geht, in der er darum bittet, dass Gott die
Menschheit vor dem Coronavirus verschont und sich der Schwächsten erbarme.
Papst Franziskus ehrt die Menschheit und wird als heiliger, freundlicher,
fürsorglicher und äußerst menschlicher Mensch in Erinnerung bleiben. Wegen
solcher Figuren hat Gott sich unserer Bosheit und unseres Wahnsinns erbarmt und
uns auf diesem kleinen, wunderschönen Planeten am Leben erhalten.
Leonardo
Boff schrieb Franz von Assisi und Franz von Rom : ein neuer
Frühling in der Kirche, Rio de Janeiro 2015 (beim Autor erhältlich: contato@leonardoboff.eco.br ); Die
Güte Gottes – Abba Jesus von Nazareth, Vozes 2025.
24. März 2025
„El Salvador braucht einen neuen Óscar Romero!“
Adveniat zum 45. Todestag
des Heiligen
„El Salvador braucht einen neuen Óscar Romero!“ Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat Pater Martin Maier anlässlich des 45. Todestages des Märtyrers und angesichts der verstörend-martialischen Bilder von 240 venezolanischen Migranten, die unter unmenschlichen Bedingungen aus den USA in das salvadorianische Mega-Gefängnis Cecot geflogen wurden – trotz der Anordnung eines US-Bundesrichters, die Flugzeuge zurückzuholen. „Präsident Nayib Bukele führt El Salvador in eine Diktatur“, so Pater Maier. „Und damit ausgerechnet das mittelamerikanische Land, in dem Óscar Arnulfo Romero gegen die damalige Militärdiktatur mit friedlichen Mitteln aufgestanden ist.“ Seinen Einsatz hat der 2018 von Papst Franziskus Heiliggesprochene mit dem Leben bezahlt, als er am 24. März 1980 von einem Mitglied der Todesschwadronen im Auftrag der Militärjunta am Altar erschossen wurde.
Parallelen zwischen den
1980er-Jahren und heute erschreckend
Für den Adveniat-Hauptgeschäftsführer sind die Parallelen zwischen den 1980er-Jahren und heute erschreckend: „Damals wurde die Militärdiktatur in El Salvador von den USA mit dem Hinweis auf eine angebliche Gefahr der Machtübernahme durch die Kommunisten unterstützt. Und heute hofiert die Trump-Administration einen Autokraten, der sich anbietet, das angebliche Migrationsproblem zu lösen, indem er sein Land zum Gefängnis-Außenposten der USA macht.“
Was die medial vorgeführten und bloßgestellten Menschen erwartet, sei kein Geheimnis. Denn von Menschenrechtsorganisationen und der Kirche des Landes sei hinreichend klar dokumentiert, dass Bukele bei seinem Kampf gegen die Jugendbanden, die für die Gewalt und eine der höchsten Mordraten verantwortlich gewesen sind, keineswegs nur Mitglieder der Maras ohne jedes Verfahren weggesperrt habe. Den Vorwand dafür liefert ihm der Ausnahmezustand, mit dem er nun schon drei Jahre regiert. „Unter den mehr als 80.000 verhafteten jungen Männern sind auch tausende Unschuldige“, so Pater Maier. Die Haftbedingungen sind menschenunwürdig. Die Gefangenen litten Hunger, würden medizinisch nicht ausreichend versorgt und Folter sei an der Tagesordnung.
Kirche an der Seite der
Armen, der Ausgegrenzten und der Weggesperrten
Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt die Kirche und Menschenrechtsorganisationen in El Salvador dabei, die Gefangenen und ihre Angehörigen mit Lebensmittel- und Hygienepakten zu versorgen sowie durch Anwälte zu betreuen und vor Gericht zu vertreten. „Die Kirche gehört auch heute wieder zu den wenigen Instanzen, die an der Seite der Armen, der Ausgegrenzten und der Weggesperrten steht und für sie Partei ergreift“, erklärt der Adveniat-Hauptgeschäftsführer. Damit lebe die Kirche ihren christlichen Auftrag in der Nachfolge eines Óscar Romeros, der für Pater Martin Maier der Grund dafür war, vor 36 Jahren nach El Salvador zu gehen.
Das Wirken von Óscar Romero
prägt die Menschen bis heute
„Auf der einen Seite habe ich ihn bewundert, weil er den Weg Jesu bis zur letzten Konsequenz gegangen ist, und auf der anderen Seite war ich entsetzt, dass ein Bischof während der Heiligen Messe ermordet wurde“, so der heutige Adveniat-Hauptgeschäftsführer. 1989 studierte er in El Salvador Theologie und musste miterleben, wie sechs Jesuiten sowie die Haushälterin und ihre Tochter ermordet wurden. Mehr als 70.000 Todesopfer hat der Bürgerkrieg bis 1992 in El Salvador gefordert. Für Pater Maier steht fest: „Wir brauchen heute dringender denn je einen neuen Óscar Romero, der gemeinsam mit den Menschen aufsteht – für Gerechtigkeit, für Menschenrechte, für Demokratie.“
18. März 2025
Israels Bruch des Waffenstillstands im Gazastreifen durch seinen nächtlichen Angriff hat zu weiteren Toten und Zerstörung geführt und das Leid unschuldiger Zivilisten verschlimmert. Dies stellt eine unverantwortliche Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstands dar. Über 400 Palästinenser wurden getötet und unzählige weitere verletzt, während sie den heiligen Monat Ramadan feierten.
Darüber hinaus bleibt die Geiselnahme weiterhin ein dringendes Problem. Das Forum für Geiseln und vermisste Familien hat die erneuten Angriffe auf Gaza verurteilt und erklärt, dass die Behauptung, der Krieg werde für die Freilassung der Geiseln fortgesetzt, völlig irreführend sei und der militärische Druck Israels die Geiseln gefährde. „Wir müssen zum Waffenstillstand zurückkehren.“ Dies fügt der bereits schrecklichen Situation eine weitere schmerzhafte Dimension hinzu, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass den Verhandlungen über die zweite und dritte Phase der Waffenstillstandsgespräche volle Aufmerksamkeit geschenkt und diese umgesetzt werden, um ihre sichere Rückkehr zu gewährleisten.
Seit 16 Tagen blockiert Israel auch illegal die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter nach Gaza. Ausgehungert werden die Menschen in Gaza nicht nur durch die Gewalt, sondern auch durch die Verweigerung von Wasser, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und anderen lebensnotwendigen Gütern. Diese vorsätzliche humanitäre Krise ist ein Affront gegen die Menschenrechte und die Menschenwürde und eine bewusste Missachtung des humanitären Völkerrechts.
Unterdessen kommt es im Westjordanland zu vermehrter Gewalt durch israelische Soldaten und Siedler gegen palästinensische Gemeinden, darunter Razzien, Hauszerstörungen, Zerstörung von Olivenhainen, Entführungen sowie die Tötung und Verwundung vieler Frauen, Männer und Kinder.
Diese Eskalation hat die ohnehin schon fragile Situation noch weiter verschlechtert. Die jahrzehntelange Besetzung durch Israel, die systematischen Verstöße gegen das Völkerrecht und die anhaltende Unterdrückung des palästinensischen Volkes sind nicht zu übersehen. Wir werden daran erinnert, dass nur Gerechtigkeit, Dialog und Achtung der Menschenwürde zu einem dauerhaften und gerechten Frieden führen können.
Das Schweigen der internationalen Gemeinschaft angesichts dieser anhaltenden Verstöße setzt den Kreislauf von Gewalt und Unterdrückung fort.
Wir fordern alle beteiligten Parteien auf, die Waffenruhe wiederherzustellen und sie sowie die unterzeichneten Vereinbarungen zu respektieren.
Wir fordern die Entscheidungsträger weiterhin auf, das Völkerrecht über ihre eigenen Interessen zu stellen.
Wir beten für einen gerechten Frieden und fordern die internationale Gemeinschaft auf, mutig und entschlossen zu handeln und ein sofortiges Ende der Blockade, ein Ende der Gewalt und ein erneutes Engagement für die Umsetzung der Menschenrechte für alle zu fordern.
26. Februar 2025

125 religiöse Führer aus allen Kontinenten haben das Jubiläumsjahr der katholischen Kirche mit einem Appell an die Finanzminister der G20-Staaten begangen, sich für ein Ende der Schuldenkrise einzusetzen, die die Bemühungen zur Armutsbekämpfung und zum Klimaschutz lähmt.
In einem Brief an die Finanzminister argumentieren die Religionsführer, dass der von der G20 im Jahr 2020 geschaffene „Gemeinsame Rahmen“ zur Umstrukturierung der Schulden einkommensschwacher Länder, die vom wirtschaftlichen Schock der Pandemie betroffen sind, „nicht in der Lage ist, rechtzeitig die angemessenen Vereinbarungen hervorzubringen, von denen Millionen von Leben und Existenzen abhängen.“
Ein entscheidender Faktor sei, so die Religionsführer, dass private Gläubiger die Verhandlungen mit Ländern mit niedrigem Einkommen „verzögern“ könnten, so dass die Regierungen mehr Geld für Schulden ausgeben müssten „als für Gesundheit, Bildung oder lebensrettende Klimamaßnahmen“.
Der Brief – unterzeichnet von Kardinälen, Bischöfen und Oberhäuptern religiöser Kongregationen sowie Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen – fordert die G20-Finanzminister, die im Jubiläumsjahr am 26. und 27. Februar in Johannesburg zusammentreffen, auf, durch die Schaffung eines „fairen und funktionierenden globalen Schuldensystems“ die „biblische Praxis der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Versöhnung“ zu verkörpern.
Dieser Aufruf ist besonders dringlich geworden angesichts der jüngsten britischen Kürzungen des Entwicklungshilfebudgets infolge der Einfrierung der USAID-Gelder. Großbritannien muss jetzt eine Schlüsselrolle spielen, um die dringend notwendige Finanzreform sicherzustellen, die mehr Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Klimaschutz ermöglicht.
Maria Finnerty, Chefökonomin des CAFOD, sagte: „Die Treffen der Finanzminister und Außenminister der G20 in dieser Woche in Kapstadt sind die ersten großen Treffen der G20-Regierungen in diesem entscheidenden Jubiläumsjahr. Im Rahmen der ersten afrikanischen Präsidentschaft der G20 fordern die Regierungen Südafrikas und anderer Länder des Südens Länder wie Großbritannien auf, ein funktionsfähigeres globales Schuldensystem zu schaffen, da die afrikanischen Länder mit Schuldenproblemen historischen Ausmaßes konfrontiert sind.
Als globale Schuldensupermacht, in der mehr als 90 % der Schulden von Ländern mit niedrigem Einkommen bei privaten Finanzunternehmen liegen, die englischem Recht unterliegen, muss die britische Regierung diese Woche Führungsstärke zeigen, indem sie die kraftvollen Worte religiöser Führer beherzigt, die eine sinnvolle Schuldenreform fordern. Es genügt nicht, an den Rändern herumzubasteln: Die Welt braucht funktionierende Mechanismen zur Schuldenbereinigung, die die Schulden auf ein wirklich tragbares Niveau reduzieren und räuberische und unverantwortliche Kreditvergabe und Kreditaufnahme verhindern.“
Die religiösen Führer aus Ländern wie Südafrika, Brasilien, den USA und Japan schreiben:
„Als religiöse Führer sind wir zutiefst beunruhigt über die Auswirkungen, die die aktuelle Schuldenkrise auf das Leben der Ärmsten und Verletzlichsten auf der ganzen Welt hat.
„Umschuldungen im Rahmen des [gemeinsamen Rahmens] dauern dreimal länger als frühere Verfahren, während private Gläubiger – die heute die weltweit größte Gläubigergruppe darstellen – die Verhandlungen verzögern und höhere Rückzahlungen verlangen können, als sich die Schuldnerländer leisten können.
„Dies führt dazu, dass ihre Bürger Hunger, keinen Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen, eine bröckelnde Infrastruktur und die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise ertragen müssen.“
Die Religionsführer fordern in den wichtigsten G20-Ländern Gesetze, um „sicherzustellen, dass sich private Kreditgeber am Schuldenerlass beteiligen und die Zahlungen an private Kreditgeber während der Verhandlungen aussetzen.“
Die Religionsführer bezeichnen das Jubiläumsjahr, das die katholische Kirche im Jahr 2025 feiert, als einen wichtigen Moment für die Finanzminister, mit „Mut, Solidarität und Mitgefühl“ zu handeln.
Die Unterzeichner des Briefes erkennen außerdem den Appell von Papst Franziskus an, dass sich die Entscheidungsträger im Jubiläumsjahr mit der globalen Schuldenkrise befassen sollen.
Der vollständige Brief folgt unten.
Brief globaler Religionsführer an die Finanzminister der G20 zur globalen Schuldenkrise
Sehr geehrte G20-Finanzminister,
In diesem Jubiläumsjahr 2025, einem Jahr der materiellen und spirituellen Befreiung, hat Papst Franziskus uns alle ermutigt, „Pilger der Hoffnung“ zu sein und uns damit einem der dringendsten Probleme zu widmen, mit denen wir konfrontiert sind: der akuten globalen Schuldenkrise.
Als religiöse Führer sind wir zutiefst beunruhigt über die Auswirkungen, die die aktuelle Schuldenkrise auf das Leben der Ärmsten und Schwächsten auf der ganzen Welt hat. Heute ist der Handlungsbedarf noch größer als beim letzten Jubilee-Jahr im Jahr 2000, als die erste Kampagne zum Schuldenerlass gestartet wurde: 3,3 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Weltbevölkerung – leben heute in Ländern, die mehr für die Schuldentilgung ausgeben als für Gesundheit, Bildung oder lebensrettende Klimamaßnahmen.
Wir sind der Ansicht, dass der Gemeinsame Rahmen der G20 nicht in der Lage ist, rechtzeitig die angemessenen Vereinbarungen zu erzielen, von denen Millionen von Menschenleben und Existenzgrundlagen abhängen. Umschuldungen im Rahmen dieses Rahmens dauern dreimal länger als frühere Verfahren, während private Gläubiger – mittlerweile die größte Gläubigergruppe weltweit – Verhandlungen verzögern und höhere Rückzahlungen verlangen können, als sich die Schuldnerländer leisten können. Diese Ineffizienz und Ungerechtigkeit hat Länder, die dringend Hilfe benötigen, davon abgehalten, sich an dem Rahmen zu beteiligen. Ihre Bürger müssen Hunger, fehlenden Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen, bröckelnde Infrastruktur und die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise ertragen.
Wir brauchen ein gerechtes und funktionierendes globales Schuldensystem. Die Tradition des Jubeljahres fordert den Erlass von Schulden, die Rückgabe von Land und die Freilassung von Sklaven. Diese biblische Praxis verkörpert Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Versöhnung und bietet einen erneuerten Bund mit Gott und Harmonie innerhalb der Gemeinschaft. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze rufen wir Sie dazu auf:
Setzen Sie sich für einen Rahmen
für einen Schuldenerlass ein, der die Schuldenzahlungen auf ein wirklich
bezahlbares Niveau senkt, die Schuldenzahlungen während der Verhandlungen über
den Schuldenerlass aussetzt, den Schuldnern vor der Antragstellung Zusicherungen
eines ausreichenden Schuldenerlasses bietet und alle Kreditgeber zur Teilnahme
verpflichtet.
Verabschieden Sie in wichtigen Rechtsräumen Gesetze, um sicherzustellen, dass
private Kreditgeber am Schuldenerlass teilnehmen und die Zahlungen an private
Kreditgeber während der Verhandlungen aussetzen.
Reformieren Sie die internationalen Finanzinstitutionen und stellen Sie sicher,
dass die Schuldnerländer angemessen vertreten sind und dass Menschen- und
Umweltrechte in die Bewertung der Schuldentragfähigkeit und die politischen
Bedingungen einbezogen werden.
Unterstützen Sie die Schaffung einer UN-Schuldenkonvention, um Regeln zur
Lösung/Bewältigung von Schuldenkrisen, zur verantwortungsvollen Kreditvergabe
und -aufnahme und zur Einrichtung eines öffentlichen globalen Schuldenregisters
zu vereinbaren, damit alle Kreditgeber und Kreditnehmer zur Verantwortung
gezogen werden.
Mit diesen Schritten wird nicht nur die unmittelbare Schuldenkrise bewältigt, sondern auch der Grundstein für ein gerechteres und widerstandsfähigeres globales Finanzsystem gelegt. Als religiöse Führer fordern wir Sie auf, in diesem Jubiläumsjahr Pilger der Hoffnung zu sein und mit Mut, Solidarität und Mitgefühl zu handeln.
Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören:
Kardinal Stephen Brislin, Erzbischof von
Johannesburg; Präsident
Kardinal Vicente Bokalic Iglic CM,
Erzbischof von Santiago del Estero; Mitglied des Dikasteriums für
Evangelisierung,
Kardinal Jaime Spengler, OFM, Erzbischof von Porto Alegre;
Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates,
Kardinal Carlos Aguiar Retes, Erzbischof von Mexiko; Primas von
Mexiko
Kardinal Isao Kikuchi, SVD – Präsident, Caritas Internationalis; Erzbischof von Tokio
Rev. Dr. Anne Burghardt – Generalsekretärin, Lutherischer Weltbund
Bischof Susan C. Johnson – Nationalbischof,
Evangelisch-Lutherische Kirche in Kanada
Reverend Dr. Setri Nyomi – Generalsekretär, Weltgemeinschaft
Reformierter Kirchen
Schwester Luzia Premoli, SMC – Provinzoberin, Comboni-Missionsschwestern, Provinz des
französischsprachigen Afrikas
Schwester Teresa Hougnon – Präsidentin, Maryknoll-Schwestern
Hochwürden Anselmo Ribeiro, SVD – Generaloberer, Gesellschaft
des Göttlichen Wortes
Herr Paul Chitnis Direktor, Jesuitenmissionen, Großbritannien
Bischof Brian McGee Bischof von Argyll and the
Isles; Präsident der SCIAF UK
Bischof Stephen Wright Bischof von Hexham
& Newcastle; Vorsitzende der CAFOD, Großbritannien
Dr. Christine Allen, Direktorin, CAFOD UK
Gaza: Humanitäre
Organisationen fordern sofortige Maßnahmen zur Bewältigung der Krise
- 28. Januar 2025
Churches for Middle East
Peace (CMEP) ruft gemeinsam mit Dutzenden internationaler humanitärer
Organisationen die internationale Gemeinschaft dringend dazu auf, sich der
eskalierenden humanitären Krise in Gaza anzunehmen. Dies geschieht, nachdem
Erkenntnisse belegen, dass die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) vor einem
Jahr vorgeschlagenen provisorischen Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, was zu
beispiellosem Leid unter den Palästinensern geführt hat.
Der gemeinsame Bericht
enthüllt eine verheerende humanitäre Lage in Gaza. Unglaubliche 93 Prozent der
befragten Hilfsorganisationen berichten von einer deutlichen Verschlechterung
der Bedingungen der Hilfsempfänger im vergangenen Jahr. Die anhaltende Krise
hat Millionen Palästinenser ohne Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung,
sauberem Wasser, Unterkunft und Gesundheitsversorgung zurückgelassen.
Die von den israelischen
Behörden verhängten strengen Beschränkungen haben die Situation noch
verschärft. Fast 89 Prozent der Hilfsorganisationen berichten von zunehmenden
Hindernissen bei der Einfuhr humanitärer Hilfsgüter, was ihre Fähigkeit,
lebenswichtige Hilfe zu leisten, erheblich beeinträchtigt. Obwohl der jüngste
Waffenstillstand es einigen Hilfslastwagen ermöglichte, Gaza zu erreichen,
dokumentiert der Bericht, dass diese Bemühungen weit unter dem Niveau liegen,
das erforderlich wäre, um den dringendsten Bedarf der Bevölkerung zu decken.
Die Blockade hat
katastrophale Auswirkungen auf die Existenzgrundlagen. So haben beispielsweise
83 Prozent der lebensnotwendigen Nahrungsmittelhilfe Gaza nicht erreicht, so
dass viele Bewohner mit nur einer Mahlzeit jeden zweiten Tag auskommen müssen.
Der Zugang zu sauberem Wasser ist ebenso katastrophal: Die Verfügbarkeit ist
auf lediglich 4,74 Liter pro Person und Tag gesunken – weit unter dem
international anerkannten Notfallstandard. Dieser Mangel hat zu weit
verbreiteter Unterernährung und einem hohen Risiko ansteckender Krankheiten
geführt.
Das Ausmaß der Vertreibung
und Zerstörung ist beispiellos. Militärische Offensiven und Zwangsumsiedlungen
haben 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens betroffen und 1,6 Millionen
Menschen in Notunterkünfte gezwungen. Ganze Stadtteile wurden in Schutt und
Asche gelegt und wichtige Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser und
Wassersysteme wurden systematisch zerstört. Aufgrund dieser Zerstörung sind die
Bewohner des Gazastreifens rauen Wetterbedingungen ausgesetzt und haben keinen
Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen.
Rev. Dr. Mae Elise Cannon,
Exekutivdirektorin des CMEP, betonte die Notwendigkeit einer dringenden
Durchsetzung der vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs:
„Die systematische Verweigerung humanitärer Hilfe, die Zerstörung der
Infrastruktur und die weitverbreitete Vertreibung verlangen Rechenschaft. Der
jüngste Waffenstillstand gibt zwar Anlass zur Hoffnung, er kann jedoch die
Verwüstung und das menschliche Leid des letzten Jahres nicht vergessen machen.
Gerechtigkeit, Freiheit und Würde für die Palästinenser müssen im Mittelpunkt
jeder langfristigen Lösung stehen.“
Der Bericht unterstreicht
auch die rechtlichen Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft gemäß
Artikel 1 der Genfer Konventionen und der Völkermordkonvention, Gräueltaten zu
verhindern und zu bekämpfen. Anhaltende Untätigkeit birgt die Gefahr der Mittäterschaft
bei Verstößen gegen das Völkerrecht und ermutigt zu weiteren Verstößen.
CMEP fordert zusammen mit der Koalition humanitärer Organisationen die
sofortige Durchsetzung der vorläufigen Maßnahmen des Internationalen
Gerichtshofs, um ungehinderten humanitären Zugang zu gewährleisten und das
Leben von Zivilisten zu schützen. Darüber hinaus muss die internationale
Gemeinschaft Rechenschaftsmechanismen einrichten, um Kriegsverbrechen,
Völkermord und andere Menschenrechtsverletzungen in Gaza zu bekämpfen.
Anhaltender internationaler Druck ist unerlässlich, um die Ursachen des
Konflikts anzugehen, einschließlich der Beendigung der Blockade und Besetzung
Gazas.
Lesen Sie den Bericht
hier: https://cmep.org/wp-content/uploads/2025/01/EN-Snapshot-9-Final.pdf